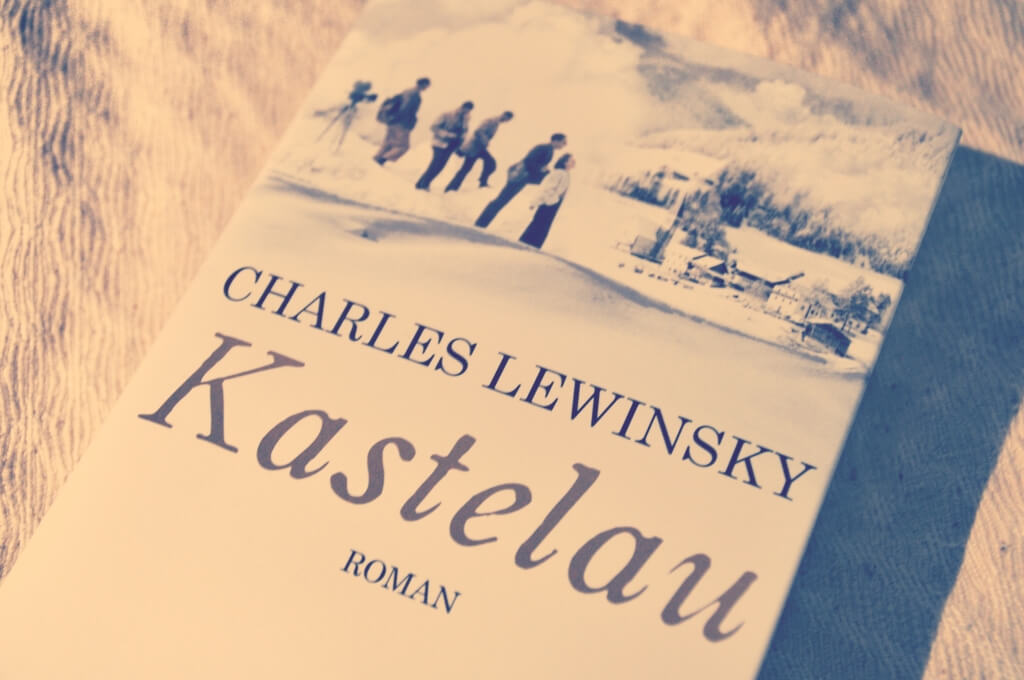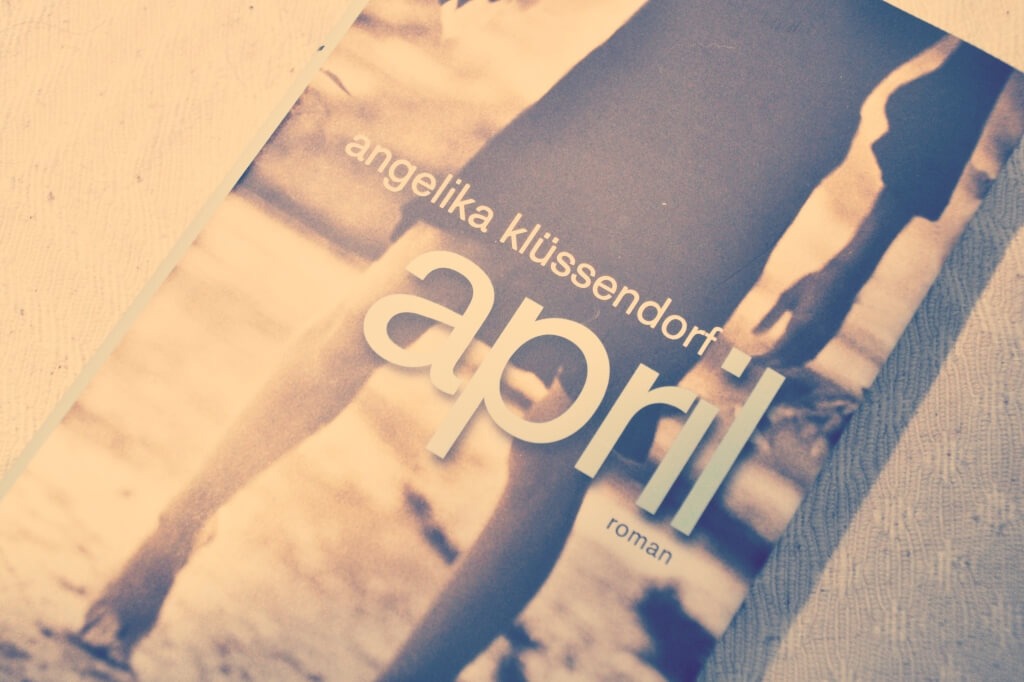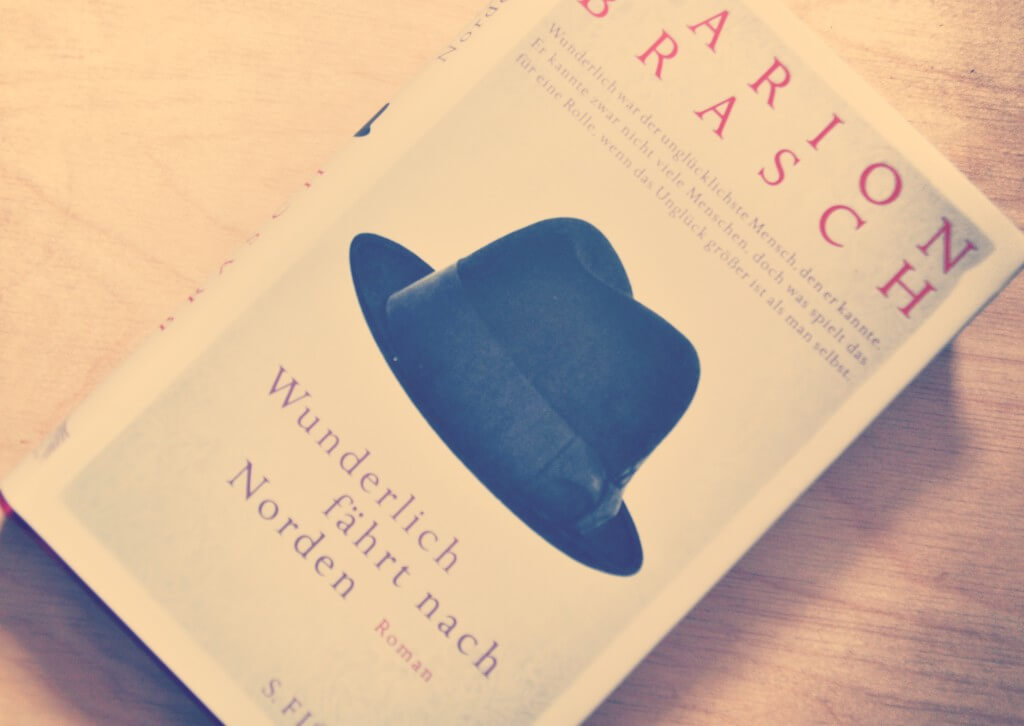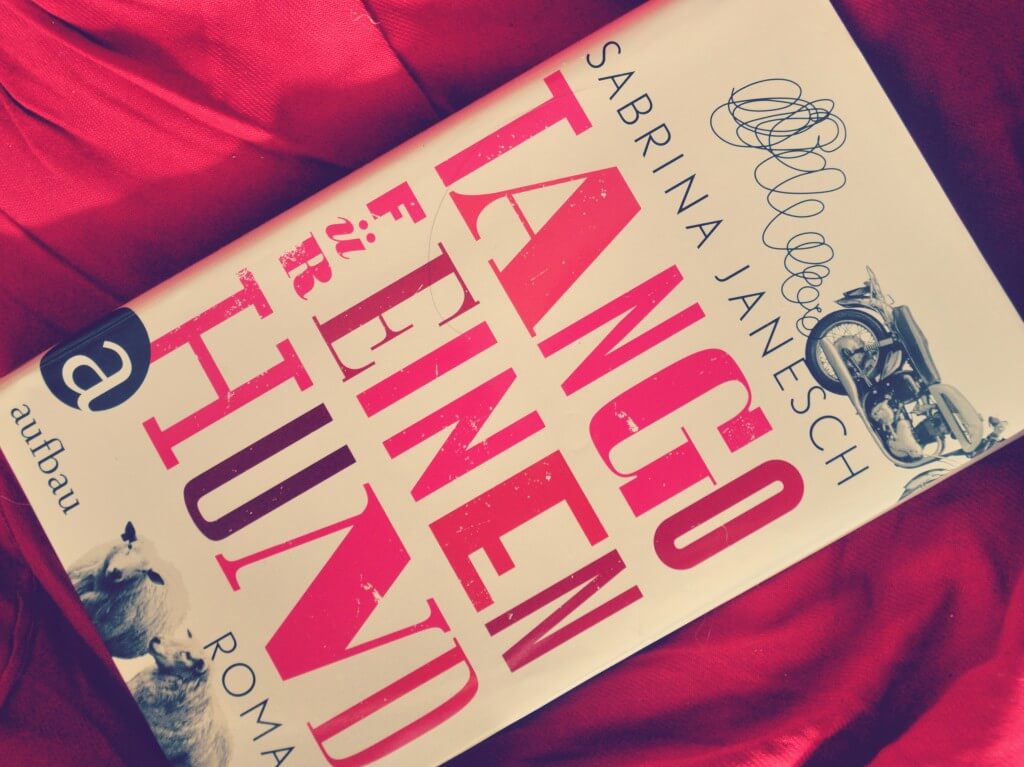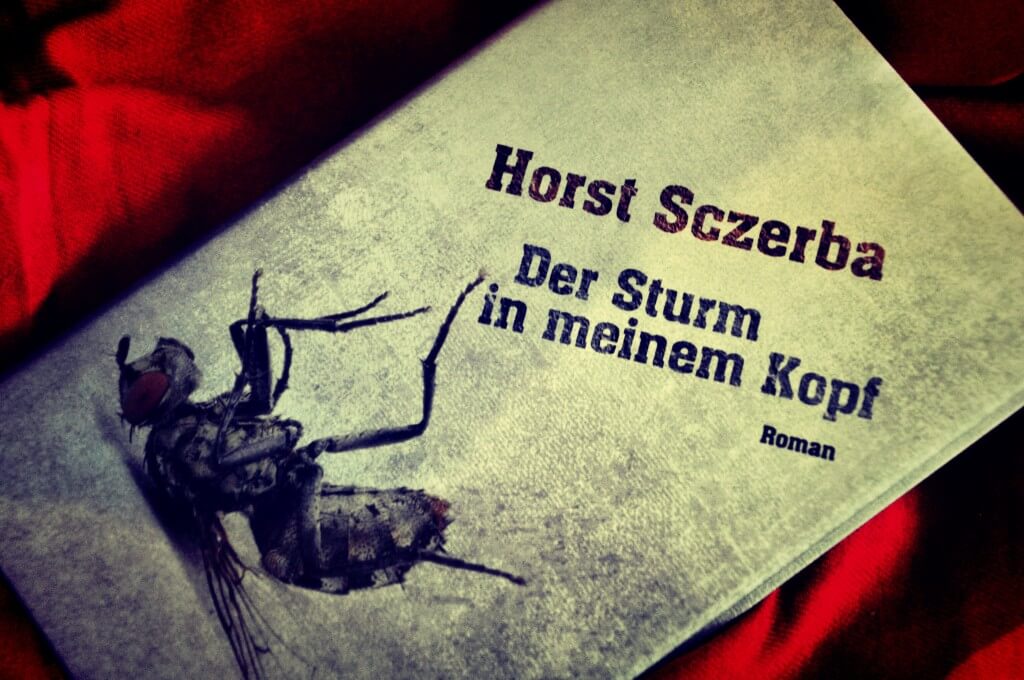Charles Lewinsky hat es mit seinem Roman Kastelau bereits vor Erscheinen auf die Longlist des Deutschen Buchpreis geschafft. Für die Shortlist hat es jedoch leider nicht gereicht. Doch kann man in diesem Fall überhaupt von einem Roman sprechen? Kastelau liest sich wie eine Mischung aus historischem Sachbuch und Tatsachenbericht, angereichert mit einer gehörigen Portion Spannung. Klingt verwunderlich, ist aber verdammt gut.
Wer sich die Welt als Film ansieht, akzeptiert überraschende Wendungen.
Es ist Winter im Jahr 1944 und die bayrischen Alpen sind noch einer der wenigen friedlichen Orte in Deutschland. Während der Krieg anderswo seinen Höhepunkt erreicht, sucht eine Filmcrew einen Ort, um weitab von Berlin überleben zu können. Die Angst davor, eingezogen zu werden, treibt sie nach Kastelau – mitten hinein in die bayerischen Alpen. Dort wollen sie einen kriegswichtigen Film drehen. Bereits die Anreise nach Kastelau ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden, denn es kommt zu einer fürchterlichen Verwechselung. Weil die Wehrmacht alle Fahrzeuge eingezogen hat, fährt die Filmcrew in bemalten Autos. In sogenannten Dekorationen. Die Bemalung der Autos führt dazu, dass sie fälschlicherweise angegriffen werden. Diesem Angriff fällt ein Großteil der Crew zum Opfer: Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, Kameramann und vier Schauspieler bleiben übrig. Einen Tontechniker – wenn auch einen gehörlosen – finden sie für ihren Film zum Glück auch in den Alpen.
Große Zeiten sind ein guter Boden für Geschichten. Die man erst wird schreiben können, wenn die Zeiten wieder klein sind.
Angekommen in Kastelau muss das Drehbuch erst einmal umgeschrieben werden, denn eigentlich fehlt nun das Personal, um überhaupt drehen zu können. Auch das Schloss, das im Film eine wichtige Rolle spielen sollte, gibt es vor Ort gar nicht. Doch die Filmcrew bleibt. Den kriegswichtigen Film voller Durchhalteparolen, den können sie nicht mehr drehen, doch solange sie so tun, als würden sie etwas drehen, gelten sie als unabkömmlich. Dass es diesen Film eigentlich gar nicht gibt, ist kein Problem: Schauspieler sind im Erfinden geübt. Die Filmcrew tut so, als ob. Als ob sie einen Film drehen würde, als ob dieser Film kriegswichtig sei. Man dreht irgendwelche Szenen im verzweifelten Versuch weit weg vom Krieg überleben zu können. Tagtäglich wird am Drehbuch geschrieben, tagtäglich werden Szenen gedreht – all das, um vor den Dorfbewohnern und dem nationalsozialistischen Bürgermeister den Eindruck zu erwecken, als würde es diesen Film wirklich geben. Im Versuch ihr Leben zu retten, kommt es in den bayrischen Alpen zu allerlei Verwicklungen: von Mord, über Liebe bis zu Verrat ist alles dabei. Im Zentrum all dessen steht der Schauspieler Walter Arnold.
Kastelau. Ich habe den Namen nie vorher gehört. Es soll dort ein altes Schloss geben, für die Innenszenen. Hoffentlich mit einer Halle, die groß genug ist für den Aufmarsch der Soldaten.
Was Kastelau von vielen anderen Romanen über den Zweiten Weltkrieg unterscheidet ist die Erfindungsgabe des Autors und sein faszinierendes Spiel mit Fakten, Fiktion und Authentizität. Charles Lewinsky gibt seinem Roman eine ganz besondere Erzählstruktur, denn er erschafft im Vorspann die Figur Samuel Saunders, Besitzer der Videothek Movies Forever. Im Jahr 2011 wird er von Polizisten erschossen, als er auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles mit einer Spitzhacke versucht den Stern des Schauspielers Arnie Walton zu zerstören. Charles Lewinsky bringt sich an dieser Stelle selbst ins Spiel: er behauptet, in einem Archiv in der East Melnitz Street, ein Konvolut aus Briefen, Listen, Notizen, Ausdrucken und Tonbändern gefunden zu haben (alles rein fiktiv natürlich). Aus diesem Konvolut hat er im Sinne einer Rekonstruktion einen Text erstellt, darunter befinden sich Tagebuchaufzeichnungen von Drehbuchautor Werner Wagenknecht, ein Interview mit der Schauspielerin Tiziana Adam und immer wieder Aufzeichnungen von Samuel Saunders, in denen er voller Hass über den Schauspieler Arnie Walton schreibt, der vor vielen Jahren noch unter dem Namen Walter Arnold in den bayrischen Alpen einen Film gedreht hat.
Für die Filmequipe war der begehrte Aufenthalt in Kastelau nur so lange gesichert, als sie dort tatsächlich einen Film drehten, oder da sie den Film aus den erwähnten praktischen Gründen gar nicht drehen konnten – zumindest den Eindruck erweckten, mit Dreharbeiten beschäftigt zu sein.
Der Handlungsort Kastelau ist fiktiv, doch Charles Lewinsky erzählt eine Geschichte, die durch eine scheinbare Authentizität besticht. Der Text besteht aus ganz vielen Fragmenten, aus Ausdrucken und Transkripten, es gibt auch Fußnoten und Hinweise auf Wikipediaartikel. Und doch, auch wenn man es zwischendurch kaum glauben mag: all das ist erfunden. Charles Lewinsky erzählt in all diesen Fragmenten Bruchstücke einer Geschichte, die zu Beginn so schwammig ist, dass sie kaum zu erkennen ist und im Laufe des Romans dann immer deutlicher Kontur annimmt. Das kongeniale Element dieses Romans ist, dass es eigentlich der Leser selbst ist, der aus diesen Fragmenten eine Geschichte macht, der all die Leerstellen und Lücken schließt. Charles Lewinsky liefert das Material, aus dem der Leser sich eine faszinierende Geschichte erfinden kann. Auf den ersten Seiten war ich skeptisch, zu groß erschienen mir die Lücken zwischen den Fragmenten und zu viele Zusammenhänge fehlten mir, doch mit zunehmender Dauer ist die Skepsis einer großen Begeisterung und einer ungeheuren Spannung gewichen.
Ich könnte mich auf dem Grab von Arnie Walton erschießen. Forest Lawn, natürlich, darunter macht er es nicht. Ein Wunder, dass sie ihn nicht auf dem Heldenfriedhof von Arlington beerdigt habe. So ein dramatischer Selbstmord wäre ein passender Abschluss für die Schmierenkomödie seines Lebens.
Charles Lewinsky brilliert in seinem neuen Roman Kastelau als herausragender Erzähler, der mit großer Kunstfertigkeit eine spannende Geschichte erzählt. Doch dieser Roman ist nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch ein beeindruckendes literarisches Experiment und Wagnis. Lewinsky legt keine vorgefertigte und zu Ende erzählte Geschichte vor, sondern führt den Leser an seinen Schreibtisch, auf dem all die Materialen ausgebreitet liegen. Wenn es einem gelingt, beim Lesen den Erzählfaden zu finden, dann erhält man als Leser die Möglichkeit, diesen selbst zu weben und in eine wunderbare Mischung aus Illusion und Erfindung einzutauchen. Was man dann daraus macht, liegt in der eigenen Fantasie, der eigenen Vorstellungskraft und in den eigenen moralischen Grundsätzen.