Stephanie Barts Roman Deutscher Meister ist nicht nur große Literatur, sondern auch ein großartiges Porträt eines Boxers. Es ist das Jahr 1933 und Johann Rukelie Trollmann begeistert das Boxpublikum. Doch gewinnen darf er nicht, denn er ist Sinto. Stephanie Bart erzählt nicht nur eine wahre Geschichte von einem Gewinner, der kein Gewinner sein durfte, sondern auch davon, wie der Nationalsozialismus eine ganze Gesellschaft zerfressen hat.
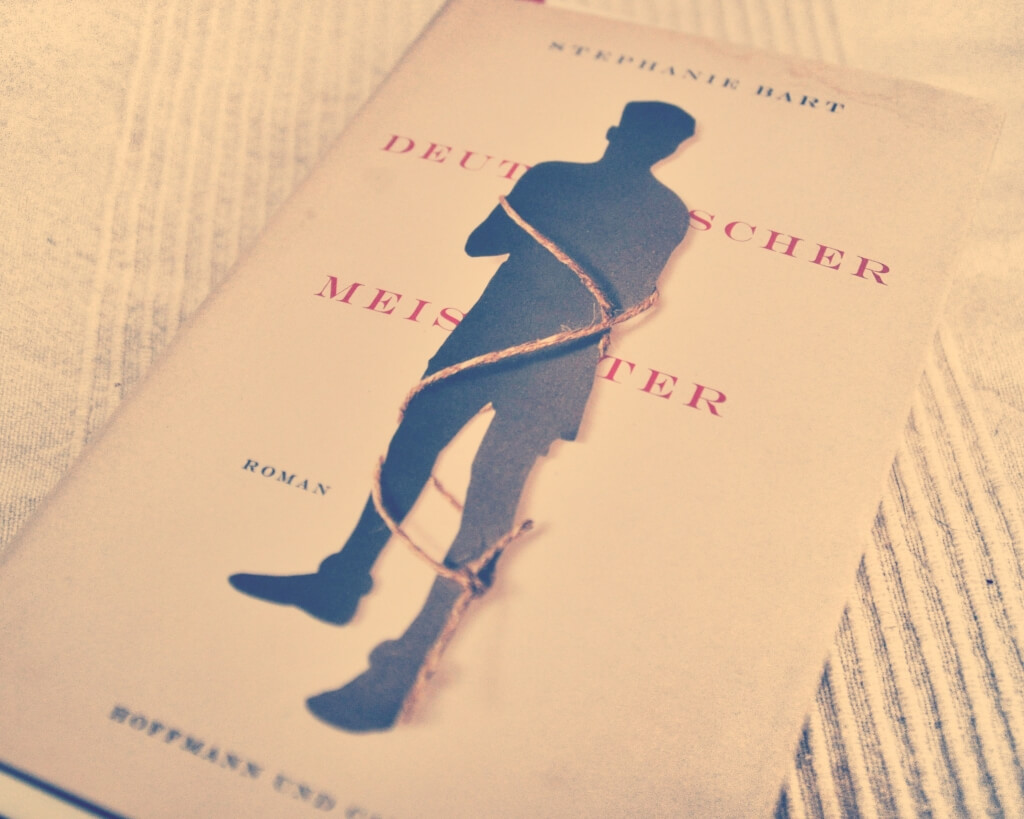
Es sind fast vier Monate, von denen Stephanie Bart in ihrem Roman Deutscher Meister erzählt – alles beginnt am 31. März 1933 und findet seinen Schlusspunkt im selben Jahr, am 21. Juli. Es sind vier Monate, die das Leben des Boxers Johann Rukelie Trollmann für immer verändern sollten. Die ganze Handlung kreist um den großen Meisterschaftskampf, der am 9. Juni 1933 stattfindet. Dem Kampf voraus ging eine Säuberung des ganzen Boxsportes – jüdische Kämpfer und Funktionäre wurden verbannt und von linientreuem Personal ersetzt. Trollmann, ein Sinto, ist einer der letzten, der der Säuberung bisher entgehen konnte – doch seine Herkunft grenzt ihn aus und der Politik ist er ein Dorn im Auge. Auch sein Nachweis ein richtiger Deutscher zu sein, hilft ihm nicht weiter. Und dennoch: er darf kämpfen, sogar um den Titel des deutschen Meisters. Nur gewinnen darf er nicht, dabei ist Trollmann beim Publikum beliebt, er boxt unkonventionell und unterhaltsam und er ist im Gegensatz zu seinem Gegner der deutlich bessere Boxer. Frauen, die dem Boxen sonst eigentlich eher fernbleiben, begeistert er mit seinem Charisma und guten Aussehen.
Trollmann hatte sich schon seit Herbst 1930 um den Titel beworben, war aber stets hingehalten und abgewiesen worden. Nicht nur, weil er Sinto war, sondern auch, weil er erst den falschen und dann gar keinen Manager gehabt hatte.
Deutscher Meister ist nicht nur das Porträt eines ungewöhnlichen Boxers, sondern darüber hinaus auch ein groß angelegtes Gesellschaftspanorama. Ein Panorama, das sich aus zahlreichen Erzählfäden und Figuren zusammensetzt, die jedoch alle um ein einziges Thema kreisen: die Machtergreifung des Nationalsozialismus. Vor dem Hintergrund des Kampfes um die deutsche Meisterschaft, erzählt Stephanie Bart davon, wie der Nationalsozialismus sich 1933 ausgebreitet hat. Einer Krebserkrankung ähnlich, hat dieser sich in allen Bereichen der Gesellschaft ausgebreitet, Metastasen gebildet und alles mit dem nationalistischen Gedankengut vergiftet.
Lasker-Schüler war weg. Nicht ganz. Kurzbein wusste eins von den Liebesgedichten auswendig. Nun gewöhnte sie sich an, das Gedicht in Gedanken sich immer wieder vorzusagen, damit es nicht verschwand. Die letzte Zeile der vierten Strophe: Niemand sieht uns, die bisher nur die Liebenden meinte, schloss jetzt die Dichterin mit ein.
Auch das Boxen blieb davon nicht verschont. Es sollte mithilfe eines Säuberungsplans auf nationalen Boden gestellt werden. Trollmann darf zwar um den Titel kämpfen, doch gewinnen darf er nicht, denn ein Zigeuner darf doch niemals deutscher Meister werden, oder? Trollmann sieht sich selbst nur als Boxer, akribisch bereitet er sich auf diesen so wichtigen Kampf vor – den Kampf seines Lebens, der von der ganzen Familie auf den Zuschauerrängen verfolgt wird. Von der deutschen Sportpolitik wird er jedoch nicht als Boxer gesehen, sondern als Ärgernis – er wird auf seine Nationalität reduziert, völlig losgelöst von seinen Boxqualitäten.
Einen Großteil des Romans machen die Kampfhandlungen aus, die von Stephanie Bart in allen Einzelheiten geschildert werden – als würde man einen Boxkampf in Zeitlupe betrachten und ab und an hat man das Gefühl, gerade selbst von einem Leberhaken getroffen worden zu sein. Diese Passagen sind von großer Eindrücklichkeit und literarischer Qualität, noch stärker beeindruckt hat mich aber das politische Panorama, das von der Autorin entworfen wird: selten zuvor habe ich eine so gute Beschreibung davon gelesen, wie sich der Nationalsozialismus schleichend in alle Gesellschaftsschichten ausbreitet. Bis es ganz normal erscheint, abends zur Bücherverbrennung zu gehen – als würde man in’s Kino gehen.
Trollmann aber legte seine Rechte auf die Halterung des obersten Seils, berührte noch einmal mit beiden Füßen den Boden, ging leicht in die Knie, ließ den Impuls fürs Hochfliegen mit einem lockeren Einatmen aus der Hüfte kommen, schnellte nach oben, warf die Beine, das rechte vorweg, das linke hinterher, hinaus, schwang gegenläufig, wie ein Vogel den Flügel, seinen linken Arm, platzierte den Körperschwerpunkt über der aufgestützten Hand, schwebte fast waagrecht in der Luft über dem Seil, sah in das Dach der Orchesterbühne, drehte auf dem Zenit der Flanke die Hüfte aus dem Ring, ließ den Körperschwerpunkt hinübergleiten, ließ jenseits der Seile ausatmend die Beine herab, setzte mit beiden Füßen auf und federte weiter.
1933 durfte Johann Rukelie Trollmann nicht gewinnen, doch Dank Stephanie Bart ist er nun deutscher Meister für die Ewigkeit – sie hat ihm ein literarisches Denkmal von beeindruckender Qualität gesetzt. Eine große Leseempfehlung!

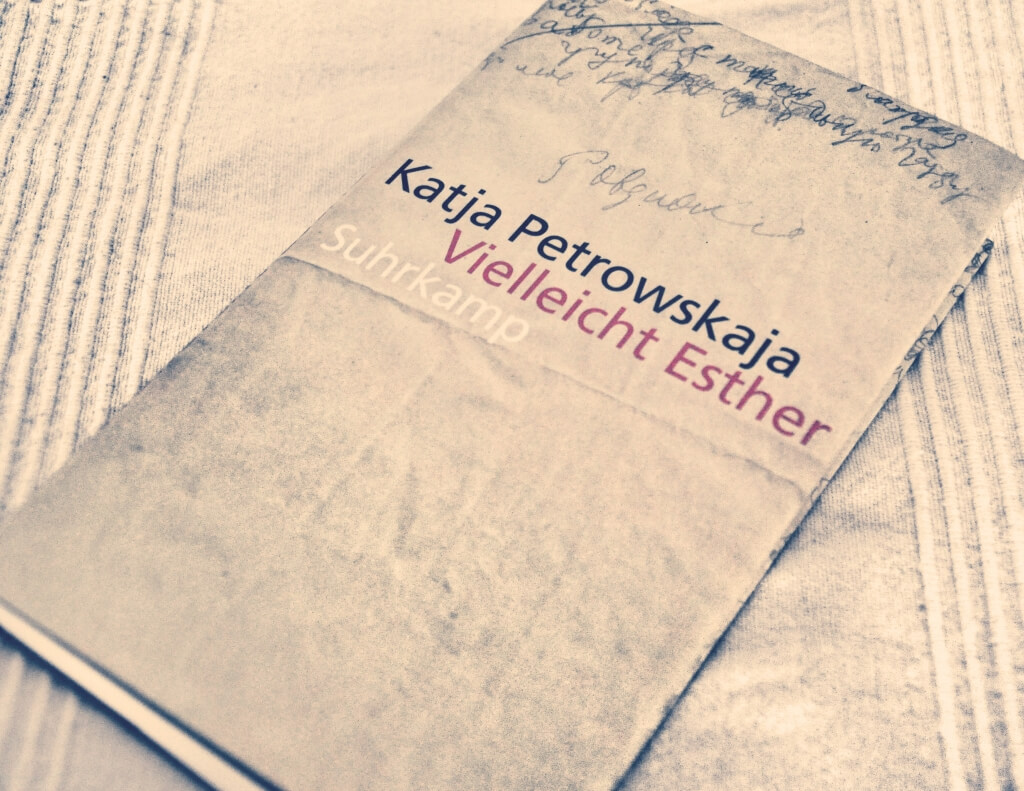
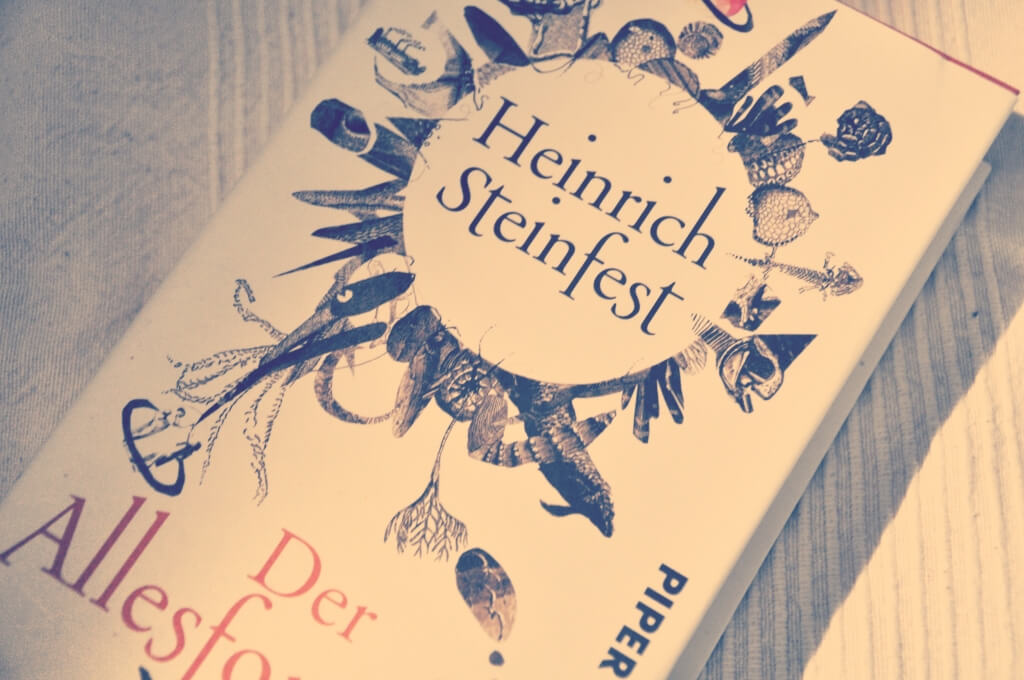 Der Beginn eines jeden Buchs leidet unter einem großen Manko: Es fehlt die Musik.
Der Beginn eines jeden Buchs leidet unter einem großen Manko: Es fehlt die Musik.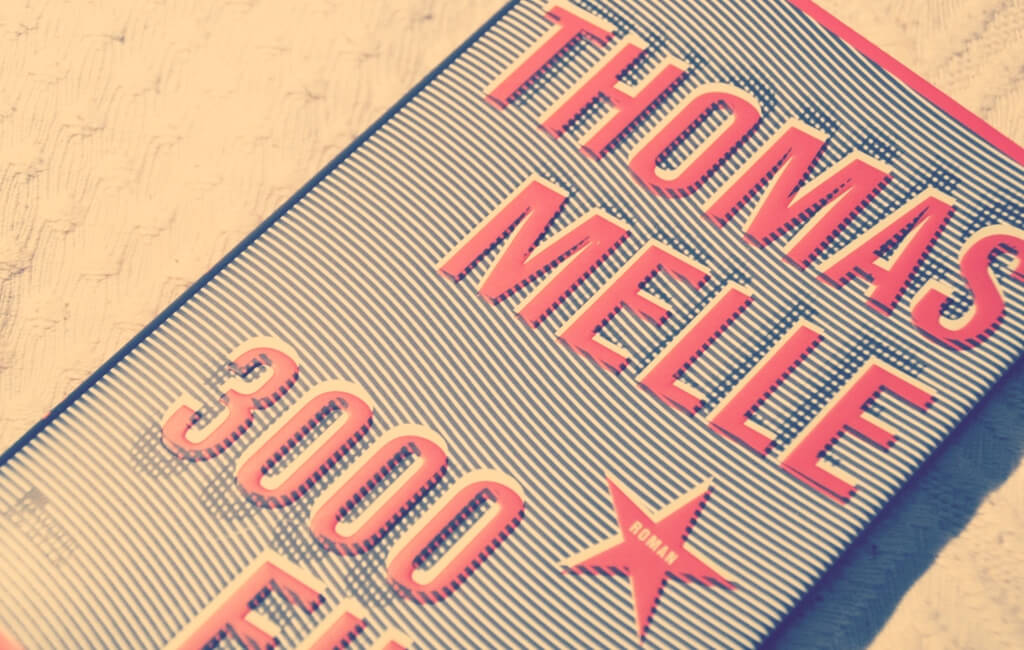
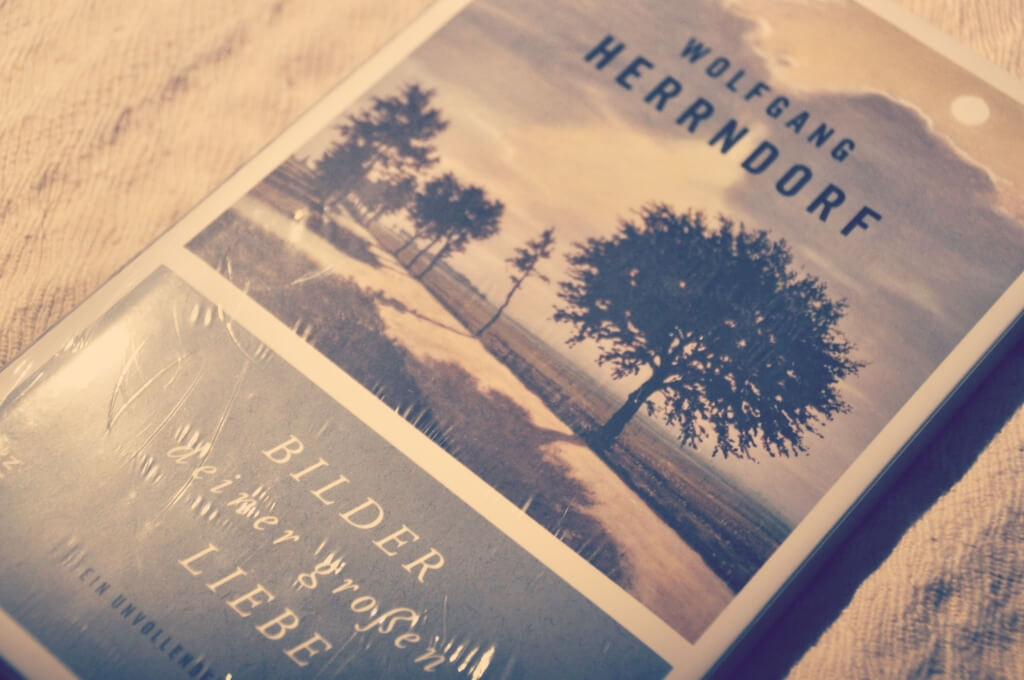 Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.
Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.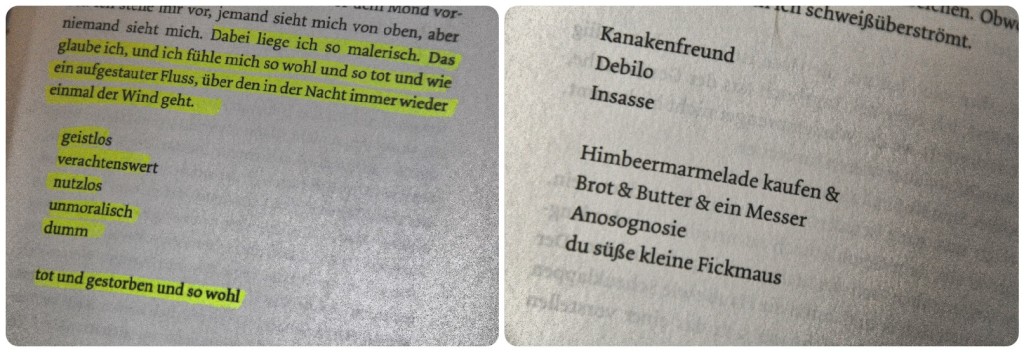
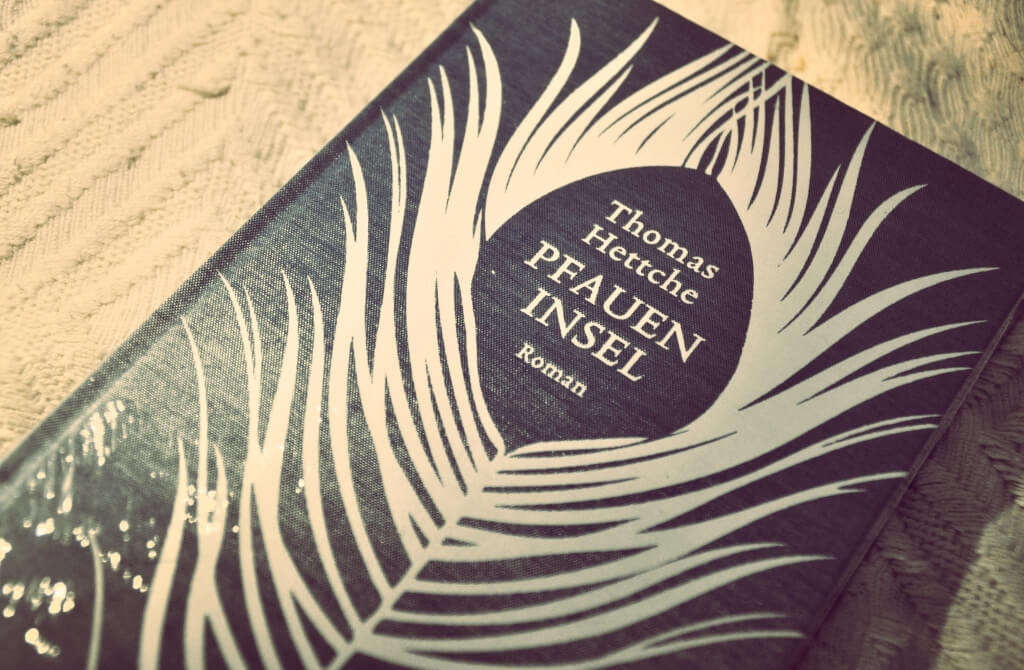 Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.
Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.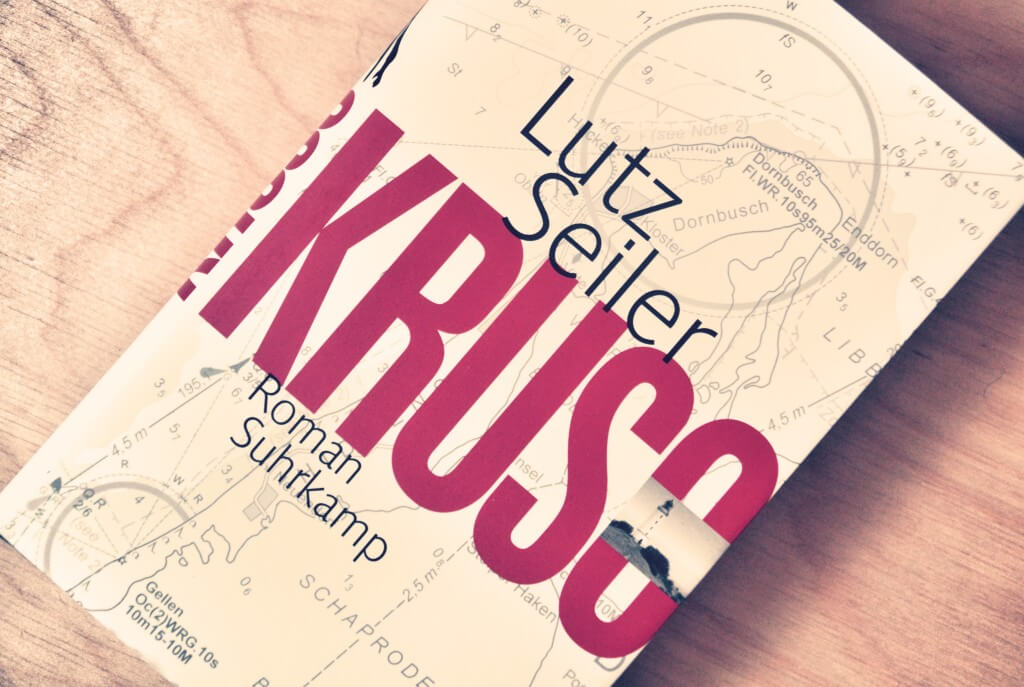 Lutz Seiler erzählt eine Geschichte in dessen Zentrum die verwunschene Ostseeinsel Hiddensee steht. Hiddensee war eine Nische für Andersdenkende, die im Gegensatz zur umzäunten DDR Flucht und Freiheit versprach und zahlreiche Urlauber anzog, für die es in den spärlich vorhandenen Privatquartieren kaum genug Platz gab. Hiddensee war die einzige bewohnte Insel, die ohne Anbindung zum Festland war. Die Nähe zu Dänemark machte sie zum Grenzgebiet, gleichzeitig war die Insel aber auch Rückzugsort vieler Intellektueller, die vor dem Regime flohen und sich mit Saisonarbeit über Wasser hielten. Manche von ihnen wagten die Flucht durch die Ostsee, nur wenige kamen an. Nach Hiddensee fuhr man, um aus dem eigenen Leben zu fliehen. Man könnte auch von Gestrandeten sprechen, von Schiffbrüchigen. Hiddensee umwehte ein Hauch von Romantik, ein Gefühl von Freiheit und die Atmosphäre eine große, gemeinsame Familie zu sein.
Lutz Seiler erzählt eine Geschichte in dessen Zentrum die verwunschene Ostseeinsel Hiddensee steht. Hiddensee war eine Nische für Andersdenkende, die im Gegensatz zur umzäunten DDR Flucht und Freiheit versprach und zahlreiche Urlauber anzog, für die es in den spärlich vorhandenen Privatquartieren kaum genug Platz gab. Hiddensee war die einzige bewohnte Insel, die ohne Anbindung zum Festland war. Die Nähe zu Dänemark machte sie zum Grenzgebiet, gleichzeitig war die Insel aber auch Rückzugsort vieler Intellektueller, die vor dem Regime flohen und sich mit Saisonarbeit über Wasser hielten. Manche von ihnen wagten die Flucht durch die Ostsee, nur wenige kamen an. Nach Hiddensee fuhr man, um aus dem eigenen Leben zu fliehen. Man könnte auch von Gestrandeten sprechen, von Schiffbrüchigen. Hiddensee umwehte ein Hauch von Romantik, ein Gefühl von Freiheit und die Atmosphäre eine große, gemeinsame Familie zu sein.