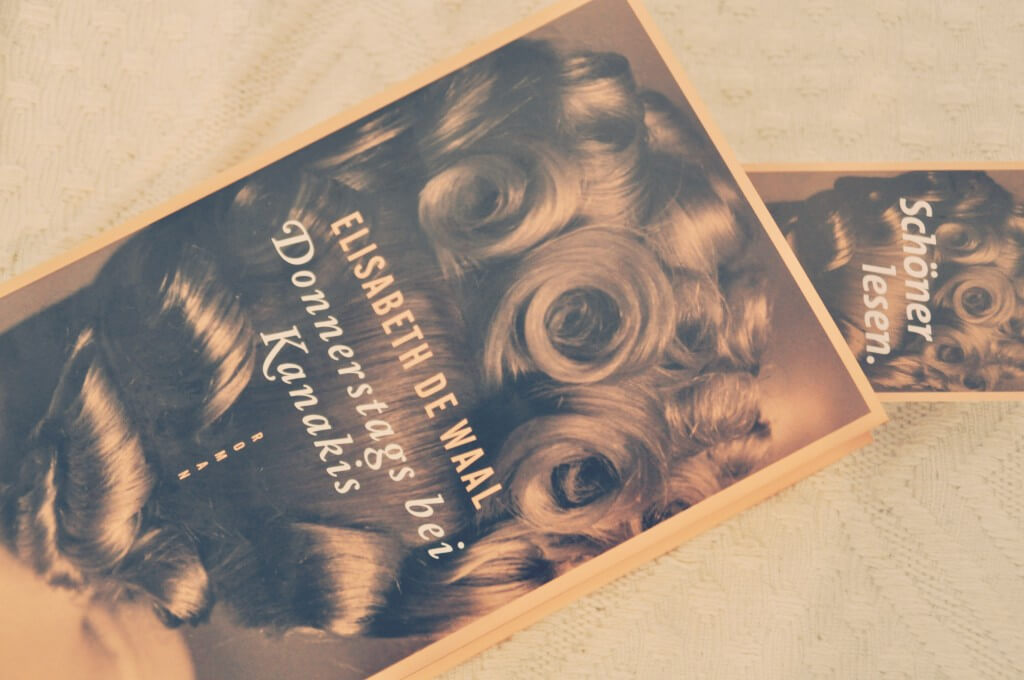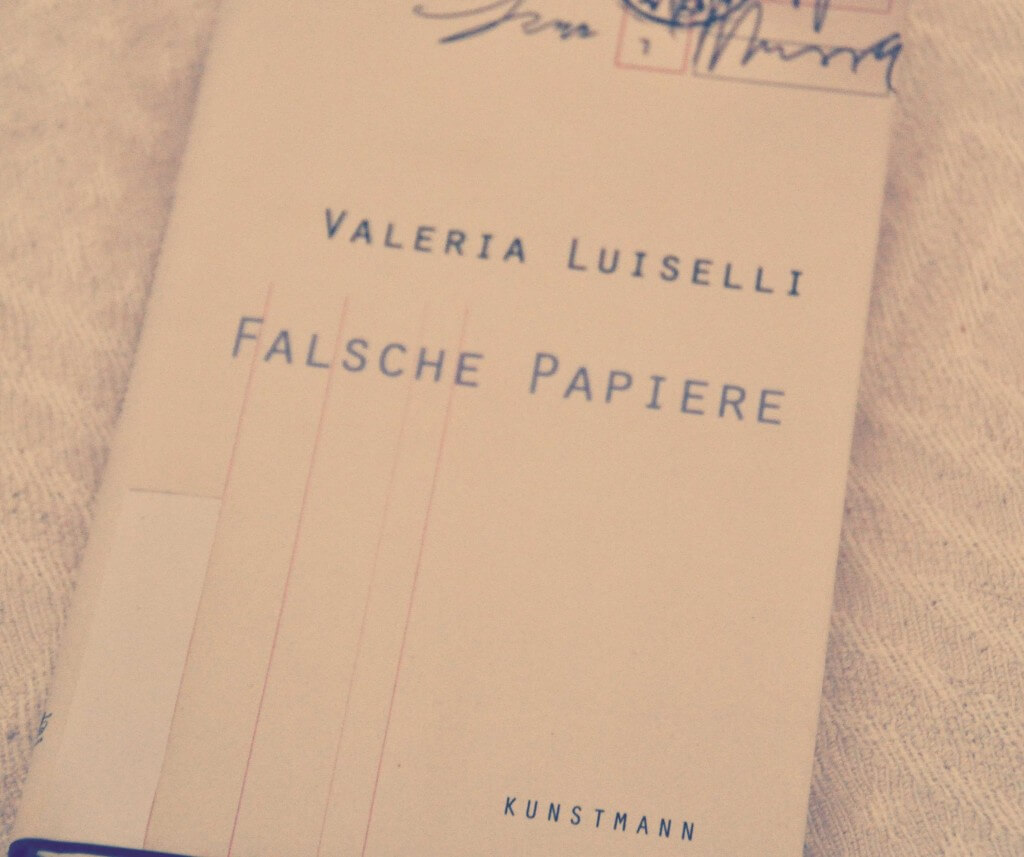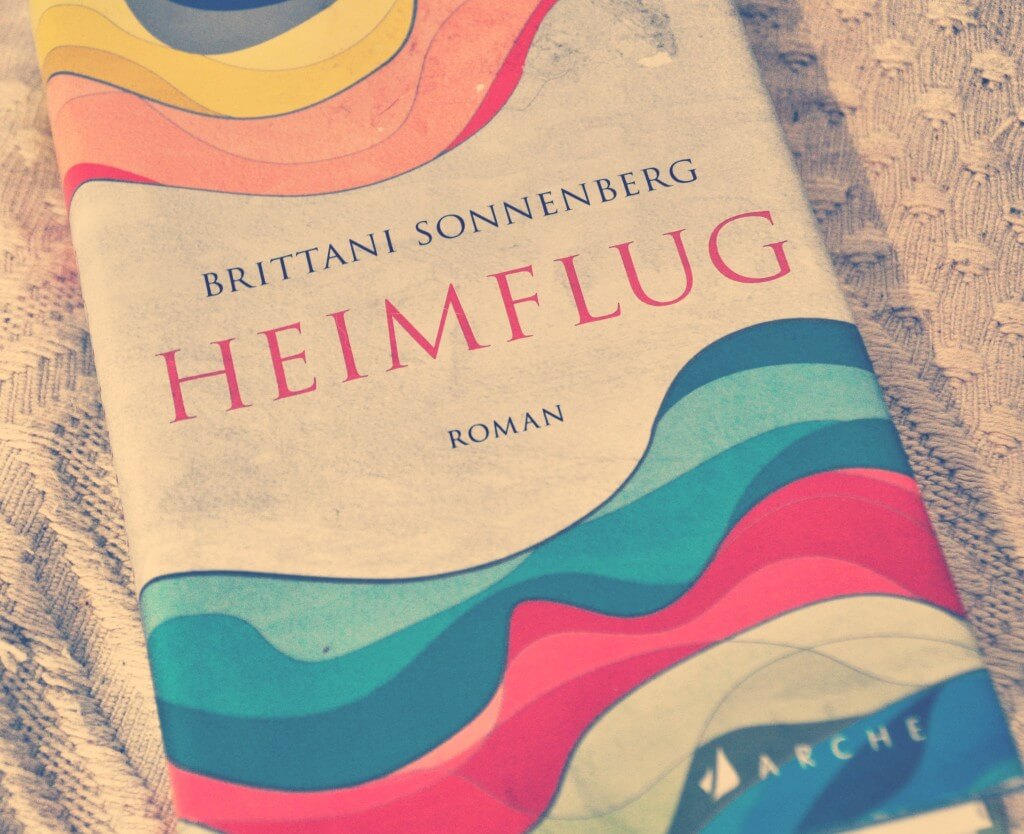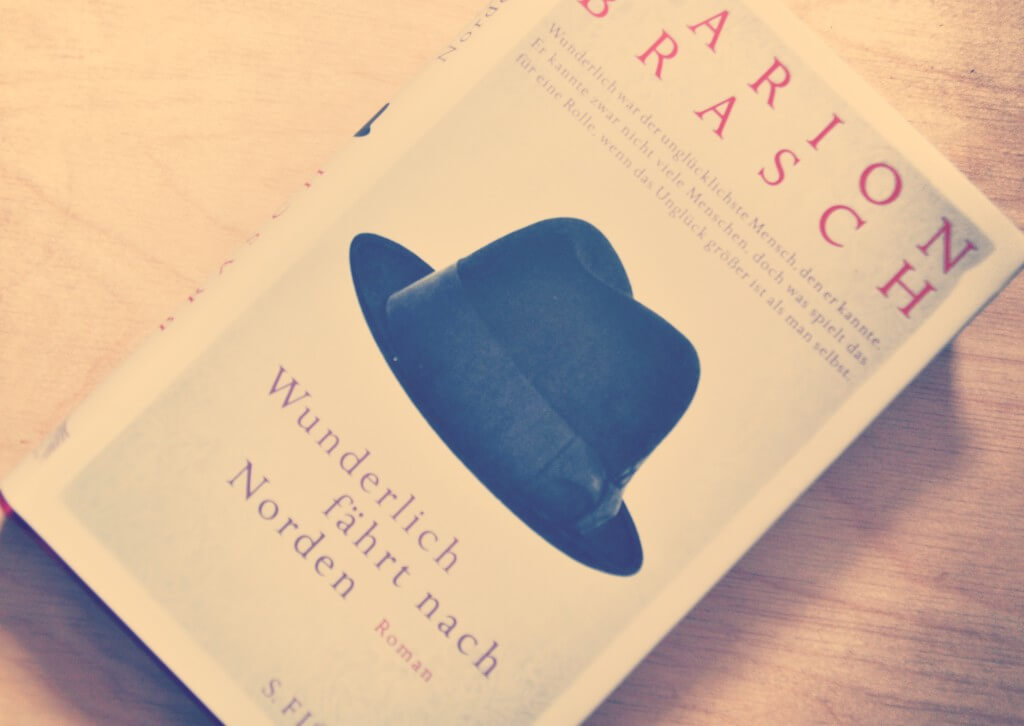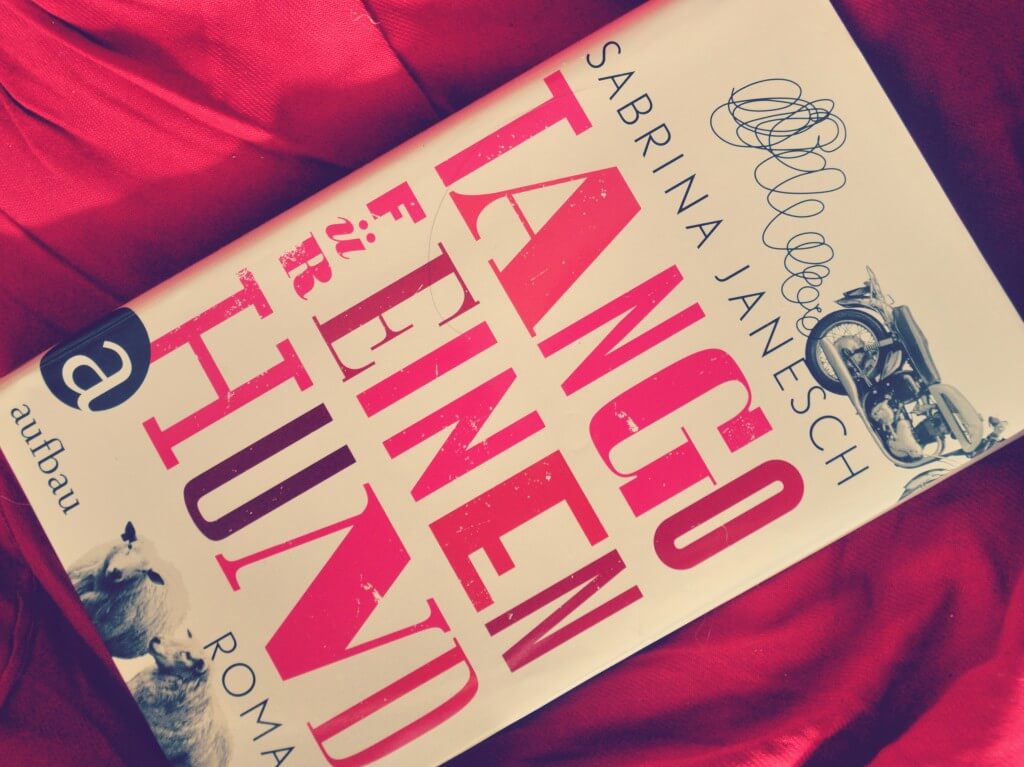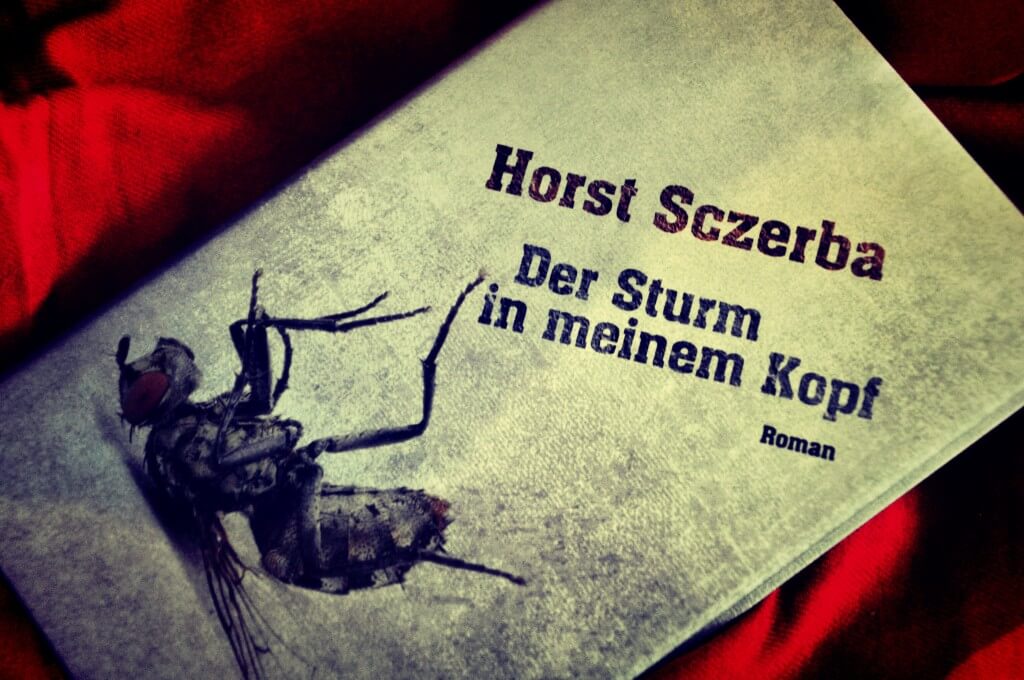Stella ist glücklich verheiratet, hat eine kleine Tochter und einen Beruf, der sie zufrieden stellt. Doch eines Tages steht ein fremder Mann vor ihrer Tür, der ein Gespräch mit ihr führen möchte. Dieses seltsame Ereignis ist der Auftakt für einen Albtraum, der Stella immer stärker die Luft zum Atmen abschnürt. Judith Herrmann legt mit Aller Liebe Anfang einen eindringlichen Roman vor und erzählt von unserer Schutzlosigkeit und den Schrecken, die ohne Vorwarnung in ein scheinbar glückliches Leben drängen können.
Ich empfinde es als ungerecht, dass sich die Verkettung der Dinge nur im Nachhinein erkennen und begreifen lässt. Und auf der anderen Seite bin ich glücklich, hab ein wildes und zuversichtliches Herz.
Der Titel des Romans – Aller Liebe Anfang – ist eine Irreführung, denn Judith Herrmann beschreibt nicht den Anfang einer Liebe, sondern den Anfang eines Albtraums, eines Schreckens, der plötzlich Einzug in das eigene Leben hält und gegen den man sich nicht wehren kann. Was kann es schon für ein Gegenmittel für eine unerwünschte Liebe geben? Für eine einseitige Liebe? Für eine Liebe, die es nur in der Phantasie des Gegenübers gibt, die in der Realität jedoch keinen Bestand hat. Ist das überhaupt Liebe? Oder Besessenheit? Eine Obsession? Eine Krankheit? Eine Heimsuchung?
[…] sie fragt sich erst später, wie sie sich aus was raushalten soll, das sie selber gar nicht veranlasst hat, wie soll sie was steuern, das jemand anders steuert.
Die 37 Jahre alte Stella wohnt gemeinsam mit ihrem Mann Jason und ihrer Tochter Ava in einem Stadthaus. Die Stadt bleibt namenlos, doch die gewählten Figurennamen deuten daraufhin, dass die Geschichte in England oder in Amerika spielen könnte. Stella arbeitet als Altenpflegerin, ihr Mann Jason baut Häuser. Er ist immer wieder für mehrere Wochen nicht zu Hause, wenn er da ist, ist die Kommunikation schleppend, schwierig. (Schön wenn Jason wiederkommt. In gewisser Weise auch schön, wenn er wieder wegfährt.) Stella ist in gewisser Weise spröde, zurückhaltend, verkopft. Obwohl sie bereits einige Jahre in derselben Straße wohnt, kennt sie kaum einen ihrer Nachbarn. Ihre Kontakte beschränken sich auf ihre Arbeitskollegen. Vieles bleibt in ihr, unausgesprochen, lediglich gedacht. An einem gewöhnlichen Mittwochvormittag ändert sich das bisherige Leben von Stella von einem Moment auf den anderen: ein fremder Mann steht vor dem Gartentor, klingelt und bittet um ein Gespräch. Auch wenn sie nicht genau sagen kann warum, hindert irgendetwas sie daran, die Tür zu öffnen. Über die Gegensprechanlage schickt sie ihn fort.
Er sagt, guten Tag. Wir kennen uns nicht. Sie kennen mich nicht. Ich kenne Sie aber vom Sehen, und ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Haben Sie Zeit.
Dieser Tag ist der Beginn eines Albtraums. Der Fremde klingelt jeden Tag an der Haustür, legt jeden Tag etwas in den Briefkasten – hinterlässt Karten, Liebesbriefe, CDs, Gegenstände, Fotos. Stella findet heraus, dass der fremde Mann ihr Nachbar ist. Mister Pfister. Während ihr Mann sie zunächst noch einer heimlichen Liebschaft verdächtigt, setzt sich in Stellas Leben schnell Angst und Schrecken fest: plötzlich beginnt sie damit, die Haustür von innen abzuschließen, blickt immer wieder aus dem Fenster, fühlt sich nie alleine, nie unbeobachtet.
Ich wünsche mir, dass du mich ansiehst. Dass du mich ansiehst und mir zuhörst. Ich wünsche mir auch, dass wir uns schon immer hätten kennen können, du wirst älter, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du wirst lächeln, wenn du mich ansiehst, es kann gar nicht anders sein. Ich werde dir zeigen, was ich sehe: die Drossel, ihr getupftes Gefieder, den Park, die Seiten des Buches, in dem ich lese –
Mister Pfister glaubt Stella zu lieben, doch für Stella ist der fremde Mann eine Bedrohung, ein Eindringling, ein Schrecken, dem sie sich nicht entziehen kann. Wie soll sie sich verhalten, wie reagieren? Soll sie das Gespräch suchen, soll sie ihn ignorieren? Wie kann sie sich schützen, wie kann sie ihre Tochter und ihren Mann schützen? Wie kann man sich vor ungewollter Liebe bewahren?
Die Stella, die Mister Pfister meint, gibt es nicht, sie hat jedenfalls mit Stella nichts zu tun. Mister Pfister hat sie erkannt, aber er meint sie gar nicht – diese Stella, die nach Feierabend in flachen Sandalen und mit einem müden, ungeschminkten Gesicht einkaufen geht, angespannt, hektisch und offenbar bedürftig, diese Stella interessiert ihn nicht. Mister Pfister interessiert sich für Stella in ihrem verschlossenen Haus. Für ihr Gesicht hinter der kleinen Scheibe neben der Tür, ihre entfernte Gestalt im Stuhl am Rand der Wiese weit weg hinten im Garten, für die wartende Stella am Schreibtisch oben in ihrem Zimmer. Diese Stella meint Mister Pfister. Eine imaginierte Stella. Seine.
Judith Herrmann legt mit Aller Liebe Anfang einen schwergewichtigen Roman vor, der sich weniger wie ein Roman liest, sondern schon beinahe Züge einer Kurzgeschichte trägt. Vieles bleibt in der Schwebe, unausgesprochen, wortlos. Insgesamt gibt es nur wenige Erklärungen: warum taucht dieser Mann so plötzlich auf? Warum sucht Stella so wenig Unterstützung? Vielleicht möchte Judith Herrmann darin spiegeln, dass es für das, was Stelle geschieht, eben häufig keine Erklärung gibt, doch mir haben Zusammenhänge gefehlt, mir hat eine Entwicklung der Figuren gefehlt. Der Roman lebt weniger von einer Geschichte, die mit Inhalt und Figuren gefüllt wird, die sich im Laufe der Erzählung entwickeln, sondern von einem diffusen Gefühl der Bedrohung, der Beklemmung, der Angst. All dies spiegelt sich auch in der Sprache wider, die lückenhaft ist und aus knappen, aneinandergereihten Sätzen besteht. Zwischendurch findet sich immer wieder das, was man als Herrmannsound bezeichnen könnte. “Träume, wie Häutungen”. “Sowieso, schon lange nicht mehr”.
Es ist grässlich, gestalkt zu werden. Es macht mein Leben kaputt. Es macht mich kaputt. Ich will, dass du damit aufhörst. Ich will, dass du nie wieder bei uns klingelst, nie wieder etwas in den Briefkasten legst, dass du verschwindest, ein für alle Mal. Hast du das verstanden. Hörst du mich?
Judith Herrmann legt mit Aller Liebe Anfang einen intensiven Roman vor, dem eigentlich alles fehlt, was einen herkömmlichen Roman ausmacht. Die Autorin legt den Umriss einer Geschichte vor, die von den Lesern selbst gefüllt werden muss – das ist stellenweise unbefriedigend. Dennoch: in all seiner Bedrohlichkeit, in all seiner Kühle, Kälte und angsteinflößenden Atmosphäre ist dieser Roman ein starkes Stück Literatur.