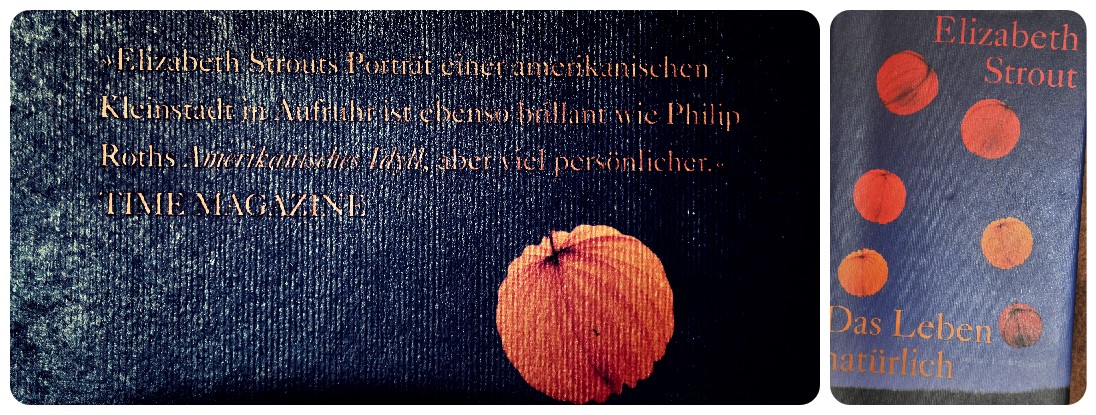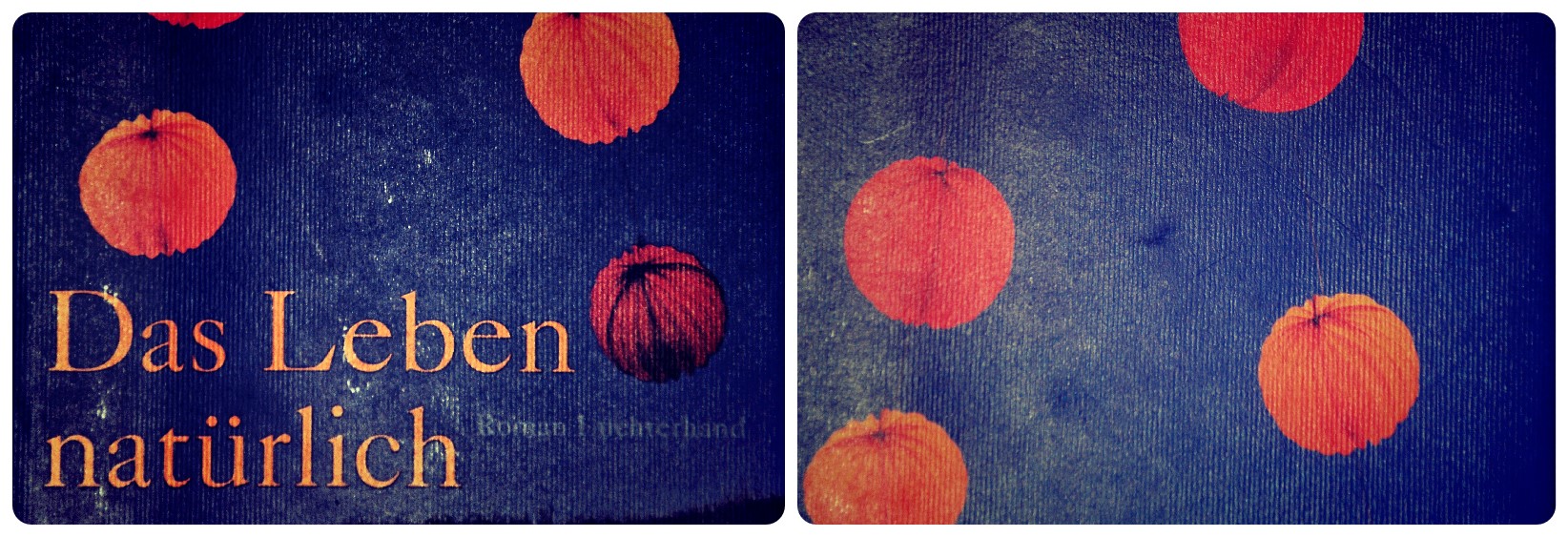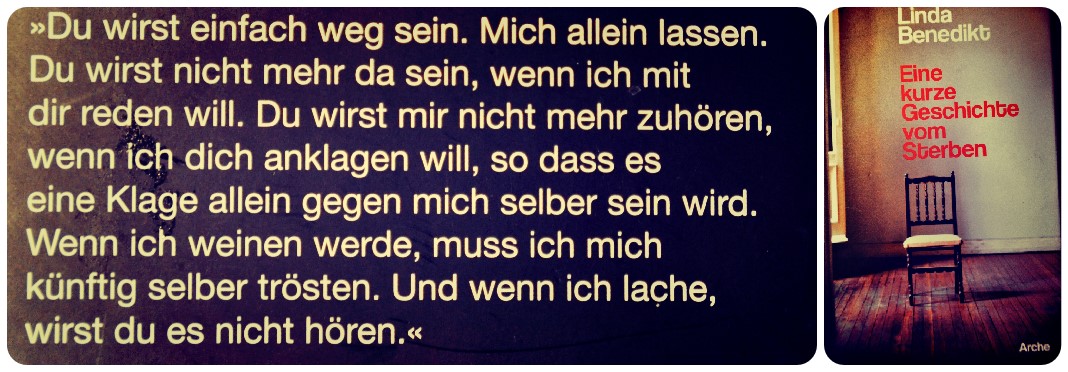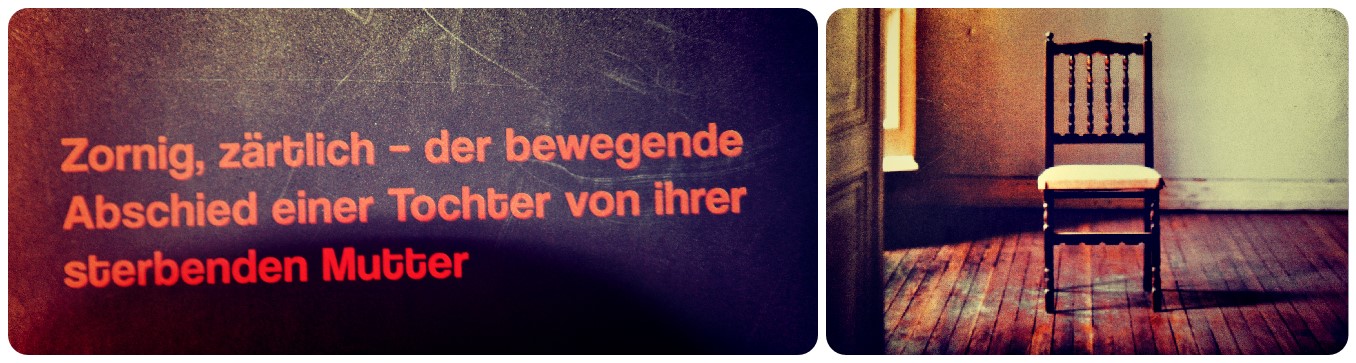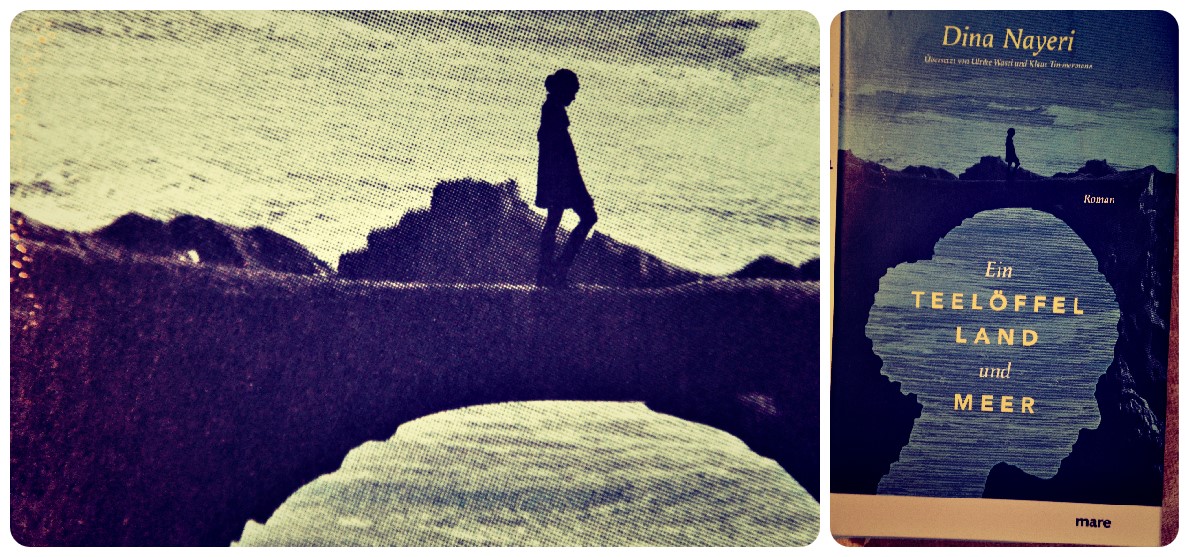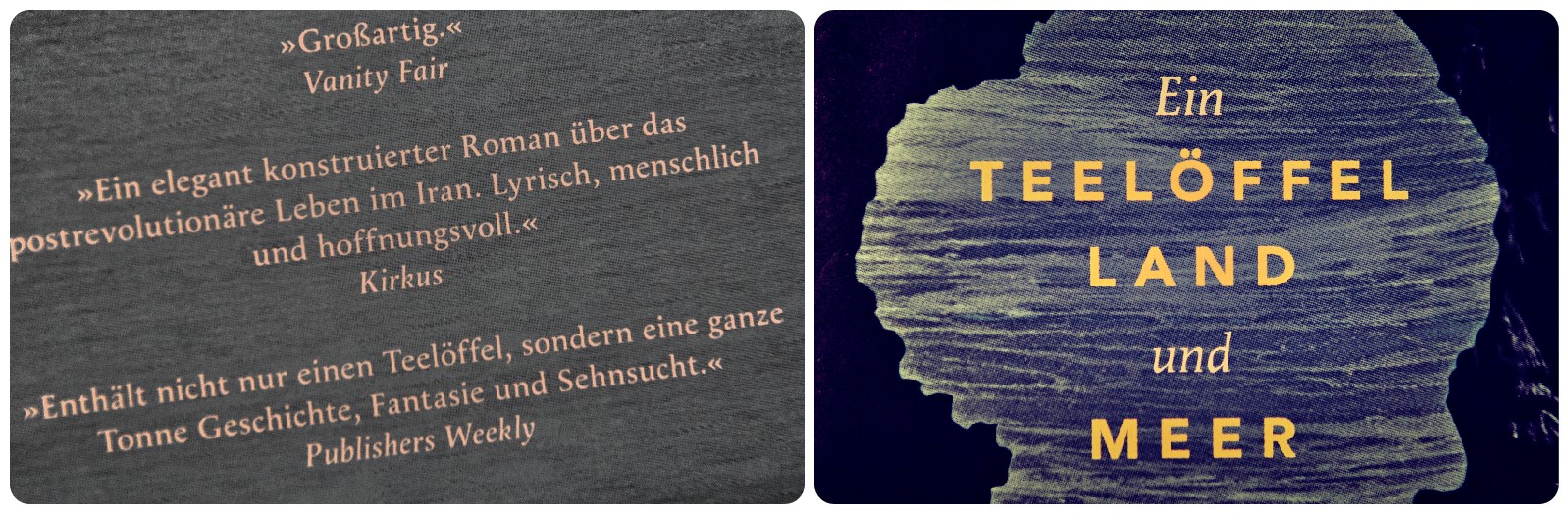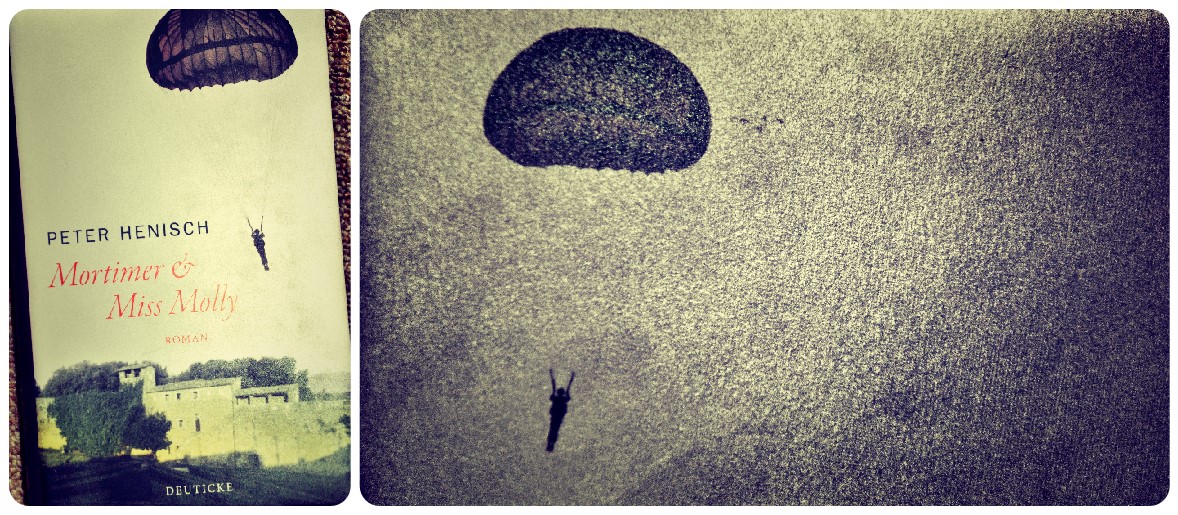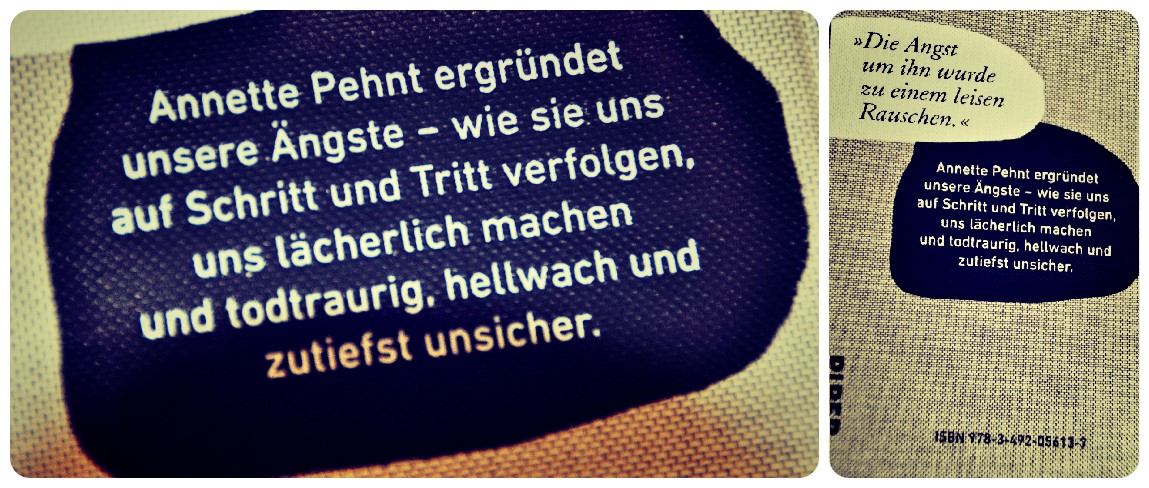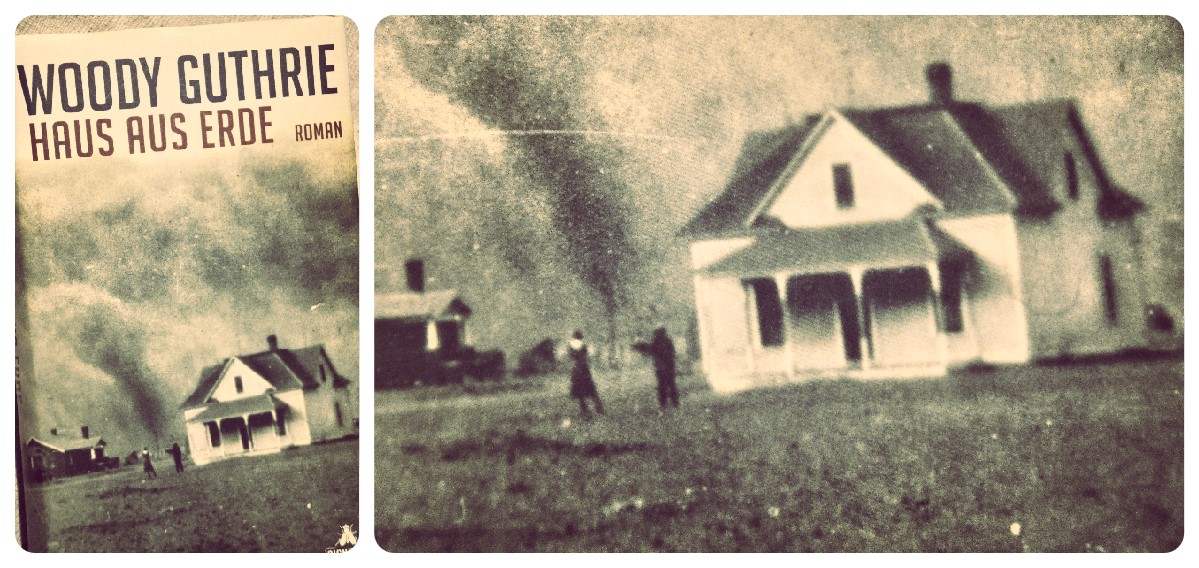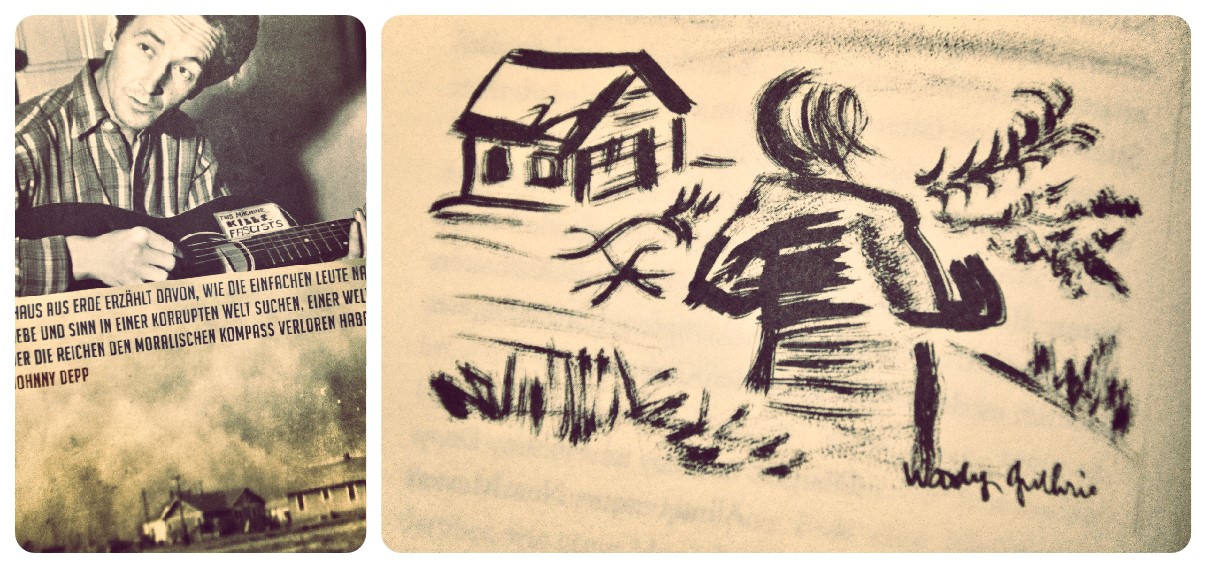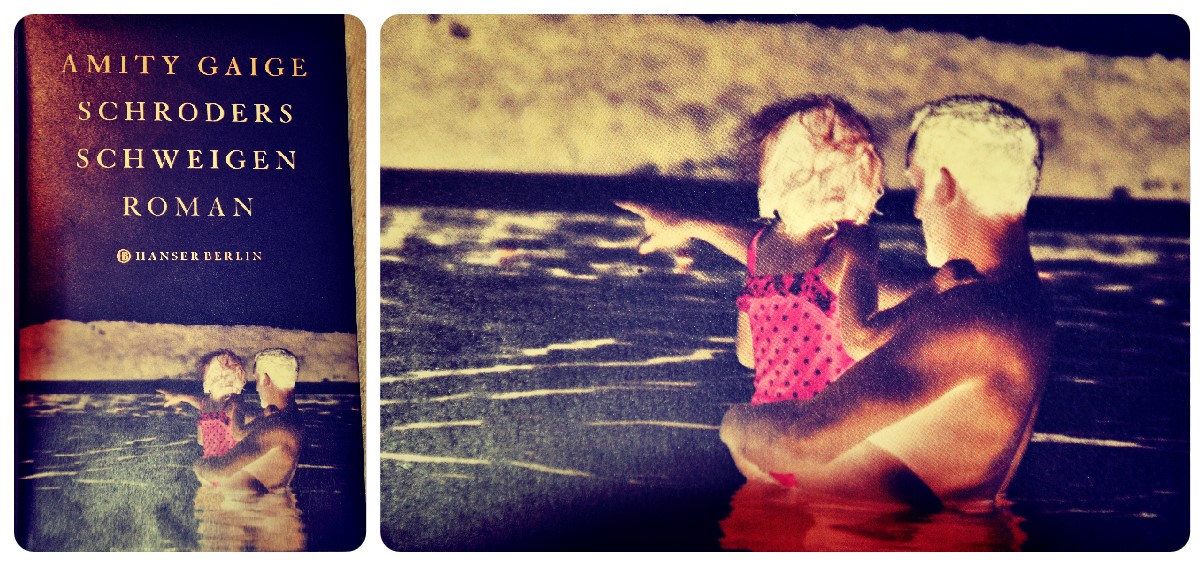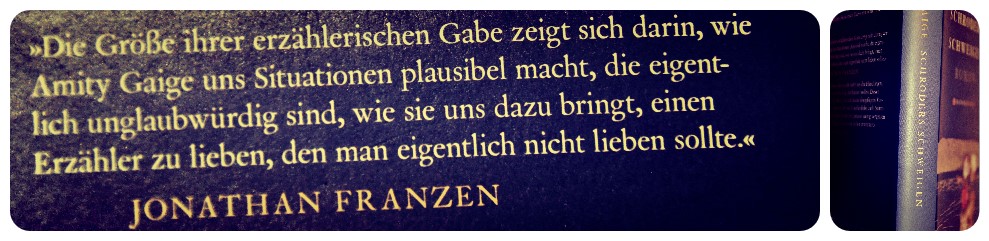Elizabeth Strout wurde 1956 in Portland, Maine, geboren und studierte nach ihrem Schulabschluss Jura. Mit dem Schreiben begann sie nach ihrem Studium und legte 1998 ihren ersten Roman “Amy & Isabelle” vor. 2009 erhielt die Autorin für ihren Roman “Mit Blick aufs Meer” den Pulitzerpreis. “Das Leben, natürlich”, ihr neuester Roman, erschien im vergangenen Literaturherbst und wurde gemeinsam von Sabine Roth und Walter Ahlers übersetzt.
“Und so fing es an. Wie bei einem Fadenspiel, das meine Mutter mit mir verband und mich mit Shirley Falls, reichten wir Erinnerungen, Neuigkeiten und Tratsch über die Burgess-Kinder zwischen uns hin und her. Wir berichteten und wiederholten.”
Shirley Falls ist eine typische amerikanische Kleinstadt: es gibt kaum Arbeit und die jungen Bewohner ziehen aufgrund einer trostlosen wirtschaftlichen Zukunft weg. Zurück bleiben die alten Menschen, die starre und eingefahrene Vorstellungen von der Welt haben und kaum offen für etwas Neues sind. Zu allem Überfluss ist Shirley Falls in den vergangenen Monaten zu einem Aufnahmeort für somalische Flüchtlinge gemacht worden. Die Geschwister Bob, Jim und Susan Burgess sind hier aufgewachsen. In Shirley Falls nennen alle sie nur die Burgess-Geschwister. Doch die einzige von ihnen, die sich dafür entschieden hat, in ihrem Heimatort zu bleiben, ist Susan. Ihr Mann hat schon vor vielen Jahren beschlossen, dass er lieber in Schweden leben möchte, als in einer amerikanischen Kleinstadt. Geblieben sind Susan der gemeinsame Sohn Zach, der mittlerweile neunzehn Jahre alt ist und viele Kindheitserinnerungen.
Zach ist ein seltsamer Junge, Elizabeth Strout zeichnet ihn als Sinnbild eines Außenseiters. Er ist schüchtern, zurückhaltend und packt im Walmart Einkaustüten ein. Eines Tages entscheidet sich Zach dazu, einen halb aufgetauten Schweinekopf in die provisorische Moschee rollen zu lassen. Warum? – Das weiß niemand so genau, wahrscheinlich nicht einmal Zach selbst. Doch das, was auch ein dummer Jungenstreich gewesen sein könnte, wird von den Medien als ein terroristisches Hassverbrechen aufgebauscht. Ein willkommener Skandal, um von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken – das FBI wurde bereits eingeschaltet.
“Unser Neffe Zachary Olson hat einen tiefgefrorenen Schweinekopf durch die Tür einer Moschee geworfen. Zur Gebetszeit. Mitten im Ramadan. Susan sagt, Zach hätte keine Ahnung, was Ramadan ist, was ich ihr unbesehen glaube – Susan wusste es auch nicht, bevor sie es in der Zeitung gelesen hat.”
Susan holt sich ihre beiden Brüder, Bob und Jim, zur Hilfe. Beide arbeiten als Anwälte in New York, doch trotz dieser mutmaßlichen Ähnlichkeit, könnten beide nicht unterschiedlicher sein: Jim ist aalglatt und karrieregeil, gemeinsam mit seiner Frau Helen lebt er in einem herrschaftlichen Anwesen, das nach dem Auszug der drei Kinder jedoch bedrückend still geworden ist. Bob hingegen ist der Prototyp des typischen Losers: die Frau ist weg, aber nicht so ganz, denn sie ist nun seine beste Freundin, er ist ein bisschen dicklich, trinkt gerne einen über den Durst und ein erfolgreicher Anwalt wird er wohl nie so wirklich werden.
Bob und Jims Rückkehr in den Ort, in dem sie aufgewachsen sind, weckt in den beiden Brüdern ganz unterschiedliche Gefühle. Längst vergessene Ereignisse schleichen sich plötzlich zurück in das Gedächtnis, das von Erinnerungen überflutet wird. Die Konfrontation mit der Vergangenheit, setzt gleichzeitig auch neue Maßstäbe für die Gegenwart. Doch Bob und Jim haben nicht viel Zeit für Sentimentalitäten. denn sie müssen gleichzeitig ihren Neffen Zach vor einer Verurteilung bewahren …
“Eine Wehmut blühte in ihm auf, so brennend, dass es ans Lustvolle grenzte: ein Verlangen, ein stummes innerliches Aufseufzen wie im Angesicht unaussprechlicher Schönheit, eine Sehnsucht, den Kopf in den breiten, schlaffen Schoß dieser Stadt zu betten, Shirley Falls.”
“Das Leben, natürlich” ist ein Roman, der mich zunächst ratlos zurückgelassen hat. Elizabeth Strout erzählt eine gut durchdachte Geschichte, sie erzählt in einer einwandfreien Prosa – gut lesbar und fesselnd. Doch im Laufe des Romans hatte ich den Eindruck, dass die Geschichte an den Rändern immer stärker ausfranst. “Das Leben, natürlich” möchte nicht nur Familienroman sein, sondern auch ein kritischer Gesellschaftsepos. Die Geschichte der drei Burgess-Geschwister, deren Lebensläufe und Beziehungsgeflecht unter die Lupe genommen wird, konnte mich begeistern. Wie sich die Brüder von ihrer Herkunft abgewendet haben, um in ein neues Leben zu starten, wird ergreifend geschildert. Ebenso berührend ist ihre Rückkehr in die heimatliche Kleinstadt, als würden sie einen Anzug anziehen, der nicht passt und überall kneift. Doch Elizabeth Strout möchte ihre Erzählung nicht auf der Ebene eines Familienromans belassen, sondern möchte daneben auch die amerikanische Gesellschaft zu Thema machen. Vorherrschend thematisiert sie den Unterschied zwischen Stadt und Land – New York und Shirley Falls wirken wie zwei Welten. Während in der amerikanischen Großstadt der Kontakt zu ausländischen Mitbewohnern selbstverständlich ist, tun sich die Bewohner von Shirley Falls mit der Aufnahme von somalischen Flüchtlingen schwer. Süffisant und mit scharfer Zunge beschreibt Elizabeth Strout die kleinstädtische Enge und Ignoranz (“Solange es nicht zu viele werden …”).
“In einer Welt, in der man von ständigem Unverständnis umgeben war – sie verstanden ihn nicht, er verstand sie nicht -, atmete man die Unsicherheit mit der Luft ein, und das zermürbte etwas in ihm; er hätte nicht mehr genau zu sagen gewusst, was er wollte, was er dachte, nicht einmal, was er fühlte.”
Elizabeth Strout erzählt in ihrem Roman “Das Leben, natürlich” eine Geschichte, die ich als Mosaik empfunden habe. Sie fügt Geschichte an Geschichte, lässt daraus einen Weg entstehen, der immer wieder in neue Richtungen führt – sich mal da und mal dorthin verzweigt, sich durch dichtes Gestrüpp schlängelt und ab und an in einer Sackgasse mündet. Als Leser muss man bereit sein, der Autorin zu folgen, die sprachgewandt und kraftvoll erzählt, doch Gefahr läuft, ihren Roman zu überfrachten.
Elizabeth Strout: Das Leben, natürlich. Roman. Luchterhand Verlag, München 2013. 400 Seiteb, € 19,99.