 Der amerikanische Autor John Cheever wurde in Massachusetts geboren und starb 1982 im Alter von achtzig Jahren. Er gilt heutzutage als einer der wichtigsten amerikanischen Autoren und wurde mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Pulitzer Preis, dem National Book Award, dem National Book Critics Circle Award, der Howells Medal for Fiction und der National Medal for Literature. Berühmt wurde John Cheever vor allem durch seine Kurzgeschichten. “Willkommen in Falconer” erschien bereits in den siebziger Jahren zum ersten Mal auf Deutsch, wurde in diesem Jahr vom DuMont Buchverlag jedoch in einer neuen Übersetzung von Thomas Gunkel noch einmal veröffentlicht und durch ein Nachwort von Peter Henning ergänzt.
Der amerikanische Autor John Cheever wurde in Massachusetts geboren und starb 1982 im Alter von achtzig Jahren. Er gilt heutzutage als einer der wichtigsten amerikanischen Autoren und wurde mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Pulitzer Preis, dem National Book Award, dem National Book Critics Circle Award, der Howells Medal for Fiction und der National Medal for Literature. Berühmt wurde John Cheever vor allem durch seine Kurzgeschichten. “Willkommen in Falconer” erschien bereits in den siebziger Jahren zum ersten Mal auf Deutsch, wurde in diesem Jahr vom DuMont Buchverlag jedoch in einer neuen Übersetzung von Thomas Gunkel noch einmal veröffentlicht und durch ein Nachwort von Peter Henning ergänzt.
“Das Hauptportal von Falconer – der einzige Eingang für Häftlinge, Besucher und Personal – war von einem Wappen gekrönt, auf dem Allegorien der Freiheit und der Gerechtigkeit die souveräne Staatsgewalt einrahmten.”
Mit diesem ersten Satz führt John Cheever den Leser in seinen Roman “Willkommen in Falconer” ein und es wird von Beginn an deutlich, dass hinter dem Hauptportal von Falconer eine andere Welt liegt, die vom Rest der Gesellschaft abgetrennt ist. Im Mittelpunkt der Erzählung steht Ezekiel “Zeke” Farragut, Mitte vierzig und Literaturprofessor, der in das Gefängnis Falconer kommt, da er seinen Bruder ermordet hat. Im Gefängnisjargon bedeutet dies, dass Farraguts Existenz auf wenige Ziffern reduziert wird: “Brudermord, bis zu zehn Jahre, Nr. 734-508-32”. Untergebracht wird Farragut in Block F:
“F steht für Ficker, Freaks, Flaschen, Fotzen, Frischfleisch, Fettärsche wie mich, Phantome, Fliegenhirne, Fanatiker, Fuzzis, falsche Fuffziger und Furzer.”
“Willkommen in Falconer” ist ein Gefängnisroman, doch bei John Cheever steht nicht unbedingt eine realistische Beschreibung des Gefängnisalltags im Mittelpunkt. Falconer ist ein Produkt der Phantasie von John Cheever und bei seinen Beschreibungen wird stellenweise auch offensichtlich, dass sie überzogen und unrealistisch anmuten. Ezekiel Farragut, der Literaturprofessor, der Konfuzius zitiert, ist kein typischer Strafgefangener. Viel wichtiger ist in diesem Roman die symbolische Bedeutung der Gefangenschaft, denn Ezekiel Farragut ist auf mehrere Arten gefangen genommen: er befindet sich in einer unglücklichen und bürgerlichen Ehe mit seiner Frau Marcia, die für ihn einer Gefangenschaft gleichkommt und er ist drogenabhängig, ein Gefängnis, aus dem er sich schon lange nicht mehr selbst befreien kann. Selbst im Gefängnis ist er auf seine tägliche Ration Methadon angewiesen.
“‘Gut. Ich hab nämlich keine Lust, mit einem Homosexuellen verheiratet zu sein, wo ich doch schon einen drogensüchtigen Mörder zum Mann habe.’
‘Ich habe meinen Bruder nicht umgebracht.’
‘Du hast ihn mit einem Schürhaken niedergeschlagen. Er ist gestorben.’
‘Ich habe ihn mit einem Schürhaken geschlagen. Er war betrunken. Er ist mit dem Kopf an den Kamin gestoßen.'”
Die Erzählung von John Cheever ist durch Rückblicke auf die Vergangenheit von Farragut geprägt, durch die schnell deutlich wird, dass Farragut sein ganzes Leben in unterschiedlichen Kontexten gefangen war und festgehalten wurde. Ein Zustand, der in Falconer lediglich fortgeführt werden soll. Doch dann kommt es anders, denn Ezekiel Farragut beginnt im Gefängnis, über sein Leben nachzudenken, über seine Bedürfnisse und Wünsche. Irgendwann bekommt man als Leser das Gefühl, Farragut befindet sich in einer nie geahnten Freiheit und nicht in Gefangenschaft.
“Farragut dachte, dass es zu dem Unfall, der als Mord bezeichnet wurde, gekommen war, weil er seine Familie, wenn er sich an sie erinnerte oder von ihr träumte, immer von hinten sah. Jedes Mal stapften sie empört aus Konzertsälen, Theatern, Sportstadien oder Restaurants, und er, als der Jüngste, ging stets am Schluss.”
In “Willkommen in Falconer” steht das Leben von Ezekiel Farragut im Gefängnis im Mittelpunkt, aber auch die Vergangenheit und Ereignisse, die dazu geführt haben, dass aus einem Literaturprofessor ein Mörder werden konnte. Zentrale Themen sind die Drogensucht Farraguts, der trotz zahlreicher Entzüge es nie geschafft hat, clean zu bleiben. John Cheever findet drastische und brutale Worte für diese Sucht.
“Am liebsten hätte er geweint und geschrien. Er befand sich unter lebenden Toten. Es gab keine Worte, keine lebendigen Worte, die seinem Kummer, diesem inneren Riss gerecht wurden.”
“Ein Leben ohne Drogen schien aus realer und geistiger Sicht ein weit entfernter und jämmerlicher Punkt in seiner Vergangenheit zu sein – mit übereinandergeschobenen Linsen von Ferngläsern und Teleskopen gewaltig vergrößert, um eine unbedeutende Gestalt an einem lange zurückliegenden Sommertag zu erkennen.”
Der Begriff “innerer Riss” beschreibt sehr treffend etwas, das Farraguts ganzes Leben durchzieht. Seine Tätigkeit als Professor und der Anspruch, den er selber an sich hat, wird mit seiner ausweglosen Drogensucht konterkariert. Der unglücklichen Ehe mit Marica stehen erste homosexuelle Erfahrungen im Gefängnis gegenüber. In einem erhellenden Nachwort von Peter Henning wird deutlich, dass dies Aspekte sind, die auch im Leben des Schriftstellers John Cheever eine Rolle gespielt haben. John Cheever scheint mit dem Betreten von Falconer, mit dem ersten Satz seines Romans, seine bürgerliche Welt, seine Verpflichtungen und Zwänge hinter sich gelassen zu haben, um Ezekiel Farragut alles Verbotene in dieser Welt der Phantasie ausleben zu lassen.
Trotz des beschriebenen Inhalts ist die Erzählung von John Cheever nicht durchgehend von einer Schwere getragen, sondern ganz im Gegenteil von einer bitterbösen Ironie geprägt. Dafür steht beispielsweise ein fortgesetzter Dialog von Farragut mit seinem Geschlechtsteil, die Beschreibungen der anderen Gefangenen oder die Tatsache, dass das Gefängnis von räudigen Katzen überflutet wird.
Ich habe “Willkommen in Falconer” mit viel Interesse gelesen, auch wenn die Bezeichnung Roman irreführend ist, da die Erzählung eher wie aus vielen kleinen Kurzgeschichten zusammengesetzt wirkt. Die Rückblicke in die Vergangenheit, die Erzählungen aus dem Leben der anderen Gefangenen, der Gefängnisalltag … stellenweise fehlt zwischen diesen einzelnen Puzzleteilchen leider die Verbindung, der Zusammenhang. Dennoch hat mich “Willkommen in Falconer” überzeugen können, auch wenn mir andere Romane von John Cheever besser gefallen haben. Sprachlich ist der Roman stellenweise brillant und hat einen starken Sog auf mich ausgeübt. Aber auch die symbolische Bedeutung des Romans hat mich beim Lesen fasziniert, auf dessen Auflösung ich jedoch leider nicht genauer eingehen kann, ohne zu viel zu verraten.
“Willkommen in Falconer” ist ein unheimlich dichtes und intensives Leseerlebnis, das mich erschöpft zurückgelassen hat. Ein Roman, den ich Liebhabern von Richard Yates nur empfehlen kann.

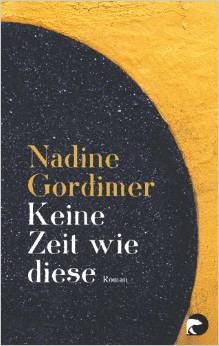 Die südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer wurde 1923 geboren und gehört sicherlich zu einer der bedeutendsten Schriftstellerin unserer Gegenwartsliteratur. 1991 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Heutzutage lebt sie in Johannesburg, Südafrika. “Keine Zeit wie diese” ist ihr neuester Roman und erschien im Herbst 2012 im Berlin Verlag.
Die südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer wurde 1923 geboren und gehört sicherlich zu einer der bedeutendsten Schriftstellerin unserer Gegenwartsliteratur. 1991 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Heutzutage lebt sie in Johannesburg, Südafrika. “Keine Zeit wie diese” ist ihr neuester Roman und erschien im Herbst 2012 im Berlin Verlag. Alain Claude Sulzer ist ein Schweizer Schriftsteller, der schon zahlreiche Erzählungen und Romane in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat. Für seine Texte hat er eine Vielzahl an Preisen erhalten, zuletzt den Médicus étranger 2008 und den Hermann-Hesse-Preis 2009. Vor einigen Monaten habe ich seinen Roman “
Alain Claude Sulzer ist ein Schweizer Schriftsteller, der schon zahlreiche Erzählungen und Romane in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat. Für seine Texte hat er eine Vielzahl an Preisen erhalten, zuletzt den Médicus étranger 2008 und den Hermann-Hesse-Preis 2009. Vor einigen Monaten habe ich seinen Roman “