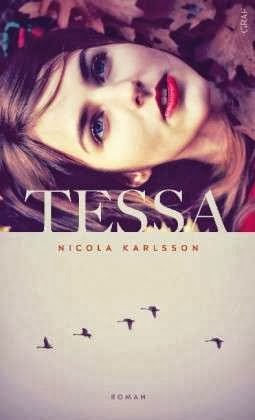 Nicola Karlsson wurde 1974 geboren und wuchs in West Berlin auf. Sie studierte Modedesign und lebt heutzutage gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in Berlin. “Tessa” ist ihr Debütroman.
Nicola Karlsson wurde 1974 geboren und wuchs in West Berlin auf. Sie studierte Modedesign und lebt heutzutage gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in Berlin. “Tessa” ist ihr Debütroman.
“Der weite Himmel. Sie fühlt sich klein, unbedeutend. Der Himmel sieht weit weg aus. Die dunklen Vögel formieren sich um. Einer der Vögel kriegt es nicht hin und fällt zurück. Hektisch flattern seine Flügel, aber er bleibt im Abseits.”
Von der ersten Seite an wird der Leser rücksichtslos in das Leben von Tessa gestoßen. Tessa ist achtundzwanzig Jahre jung, schön und begehrenswert. Sie hat einen Freund, viele Freundinnen und einige gute Bekannte. Sie hat gemodelt, Werbung gemacht und gutes Geld verdient. Doch glücklich? Glücklich ist sie nicht. Tessa sehnt sich fortlaufend nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Tessa möchte gesehen und wahrgenommen werden. Ihre Beziehung zu Nick zerbricht an ihren Forderungen, an ihrem Drang nach Beachtung, an ihrer krankhaften Eifersucht, an einem hysterischen Verfolgungswahn und dem Gefühl, nicht genug geliebt zu werden. Die Bedürftigkeit, dieses Bedürfnis nach Liebe, ist etwas, das Tessa nicht zeigen kann. Es ist etwas, über das sie nicht sprechen kann, von dem sie aber wünscht, dass es gesehen wird. Nick versteht sie nicht und um ihren Wunsch nach Liebe zu erkennen, ist er zu blind.
“Aber es macht mich müde, dir dabei zuzusehen, wie du dich kaputt machst. Diese ewige Suche nach dem Drama. Ich kann das nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf.”
Das Einzige, was Tessa dabei hilft, der Verständnislosigkeit der Welt und ihrer Mitmenschen zu begegnen, ist Alkohol. Wodka, Bier – egal was, Hauptsache, es betäubt Tessas Angst und Bedürftigkeit. Hauptsache es betäubt so stark, dass Tessa nichts mehr spüren muss. Wenn der Alkohol nicht reicht, greift sie auch zu härteren Drogen: sie nimmt Tabletten und schnupft Kokain. Wenn das Geld ausgeht, findet sich ein Mann, der Tessa Nachschub besorgt – sie besorgt sich Stoff und Nähe, doch beides wird immer schneller schal. Fühlt sich falsch an.
“Immer ist sie allein. Ihr Herz zieht sich zusammen, und ihre Brust fängt an zu schmerzen. Sie schnieft und muss wieder anfangen zu heulen, weil sie so unendlich traurig ist. Es soll alles wieder schön werden.”
Als sie und Nick entscheiden, eine Pause zu machen, wird immer deutlicher, dass von dem alten Glanz nichts mehr übrig ist in Tessas Leben. Die großen Werbeverträge sind längst ausgelaufen, nur ab und an sieht sie sich selbst noch im Kino – bevor der Film beginnt. Es ist fürchterlich, den Verfall Tessas mitzuerleben, der sich förmlich in Lichtgeschwindigkeit vollzieht – in Momenten, in denen sie sich angeekelt von Pennern in der Straßenbahn abwendet, schreit es in meinem Kopf bereits: Du bist doch genauso, Tessa! Sie bestiehlt Freunde, um Alkohol zu kaufen, auch wenn sie sich selbst schwört, das Geld wieder zurückzulegen. Womit soll sie überhaupt Geld verdienen? Von ihrer Modellagentur wurde sie schon lange nicht mehr angefragt und für ihren aktuellen Job hat sie auch schon ewig keinen Finger mehr gerührt. Genauso fürchterlich wie Tessas eigener Absturz, ist das Weggucken der Gesellschaft, in der sie sich bewegt: die Psychiaterin stellt, ohne Nachfragen, weitere Rezepte aus für Tabletten, die Tessa schon lange nicht mehr nimmt, um gesund zu werden. Der Sanitäter nimmt Tessa, trotz eines Selbstmordversuchs, nicht mit ins Krankenhaus. Ihre beste Freundin wendet sich ab, bietet aber keine Hilfe an. Niemand stellt Fragen, oder nimmt sich die Zeit zuzuhören. Tessa schreit, nein, sie verzehrt sich förmlich nach Aufmerksamkeit, doch niemand um sie herum möchte hinsehen. Unsere Gesellschaft hat kein Sicherheitsnetz für diejenigen, die ins Abseits geraten.
“Der Mann hat ihr schlechte Laune gemacht, sein abschätziger Blick, als sei sie eine Alkoholikerin.”
Tessas Leben ist ein Balanceakt, eine Gratwanderung – immer wieder droht sie vom Seil zu kippen und immer häufiger fällt sie. Die Abstürze werden von Mal zu Mal tiefer, bodenloser. Niemand ist da, um ihr zu helfen. Alle, die mal da waren, hat sie weggestoßen. Die letzten Seiten des Romans schneiden beim Lesen ins Fleisch, wie eine scharfe Rasierklinge. Ich habe sie gelesen, die letzten Seiten des Romans, immer wieder. In meinem Hals haben sie sich zu einem sperrigen Knoten zusammengeschnürt, den ich nur unter Schmerzen herunterschlucken konnte. Das Ende des Romans ist weit entfernt von einem dieser klassischen Happy Ends im Film. Genauso leer wie Tessas Vergangenheit, über die man nichts erfährt, erscheint auch die Zukunft – sie bleibt dem Leser verborgen und ich kann nur hoffen, dass es Tessa gelingt, etwas im Leben zu finden, was sie immer öfter auf dem Drahtseil halten wird.
Nicola Karlsson hat mit Tessa eine schwierige Figur geschaffen – ich habe mich dabei ertappt, wie ich mit Tessa sympathisiert habe und mich doch gleichzeitig von ihrem Selbstmitleid und dem künstlich von ihr erschaffenem Drama abgestoßen gefühlt habe. Es ist nicht leicht, Tessa zu mögen und doch ist es schwer, sie nicht zu mögen. Zu viel von einem selbst kann man in Bruchstücken ihres Charakters wiederentdecken. “Tessa” ist ein erschreckend authentisches Buch, was die Frage aufwirft, wie viel von Nicola Karlsson in ihrer Hauptfigur steckt – eine Frage, die ich nicht zu beantworten mag. Wieviel es auch sein mag: Nicola Karlsson hat uns mit “Tessa” ein schonungslos ehrliches, radikal offenes und erschreckendes Buch geschenkt. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft viel zu viele Tessas gibt und ich hoffe, dass dieses Buch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schaffen wird, um solche Menschen nicht haltlos abstürzen zu lassen, sondern sie irgendwie aufzufangen.

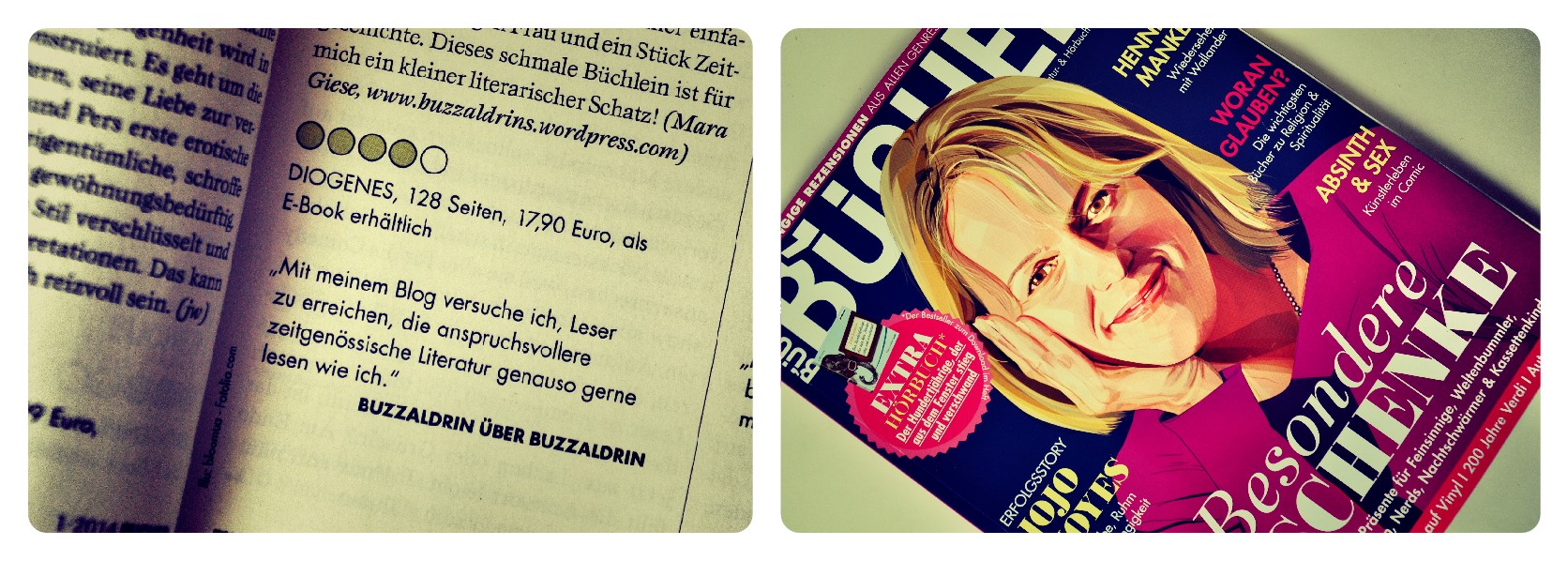
 Erich Hackl wurde 1954 in Steyr geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Hispanistik, arbeitete Hackl einige Jahre lang als Lehrer und Lektor. Später gab er seinen Brotberuf auf und war fortan als freier Schriftsteller und Übersetzer tätig. Seine Erzählungen wurden bereits in über 25 Sprachen übersetzt und einige seiner Werke sind heutzutage Schullektüre.
Erich Hackl wurde 1954 in Steyr geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Hispanistik, arbeitete Hackl einige Jahre lang als Lehrer und Lektor. Später gab er seinen Brotberuf auf und war fortan als freier Schriftsteller und Übersetzer tätig. Seine Erzählungen wurden bereits in über 25 Sprachen übersetzt und einige seiner Werke sind heutzutage Schullektüre.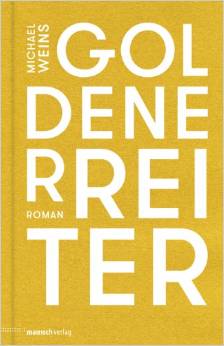 Michael Weins
Michael Weins
 Max Scharnigg arbeitet nicht nur als Autor, sondern auch als Journalist. Der 1980 geborene Autor ist unter anderem tätig für die Süddeutsche Zeitung, Architectural Digest und Nido. Vor drei Jahren erschien sein Debütroman “Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe”. In diesem Literaturherbst erschien sein neuestes Buch “Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau”.
Max Scharnigg arbeitet nicht nur als Autor, sondern auch als Journalist. Der 1980 geborene Autor ist unter anderem tätig für die Süddeutsche Zeitung, Architectural Digest und Nido. Vor drei Jahren erschien sein Debütroman “Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe”. In diesem Literaturherbst erschien sein neuestes Buch “Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau”.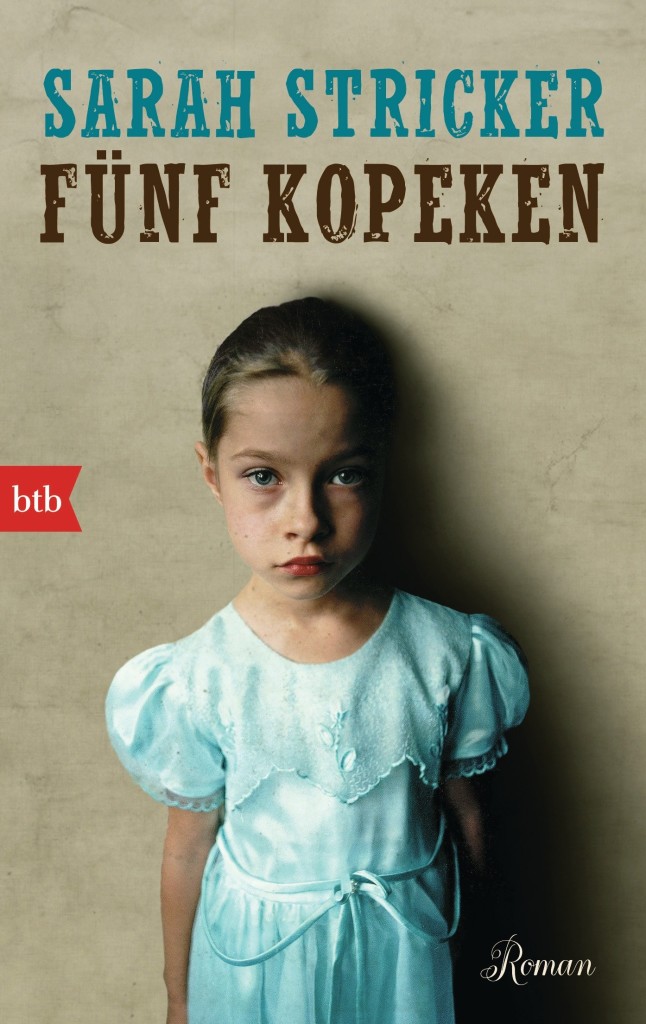 Sarah Stricker wurde 1980 in Speyer geboren und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Anschließend arbeitete sie für einige deutsche Zeitschriften, bevor es sie 2009 nach Israel zog. Der Auslöser war ein Stipendium, das sie erhielt, doch bis heute ist sie nicht zurückgekehrt. In Israel berichtet sie für deutsche und israelische Medien. Nebenbei hat sie ihren beeindruckenden Debütroman “Fünf Kopeken” geschrieben, der in diesem Literaturherbst im Eichborn Verlag erschienen ist.
Sarah Stricker wurde 1980 in Speyer geboren und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Anschließend arbeitete sie für einige deutsche Zeitschriften, bevor es sie 2009 nach Israel zog. Der Auslöser war ein Stipendium, das sie erhielt, doch bis heute ist sie nicht zurückgekehrt. In Israel berichtet sie für deutsche und israelische Medien. Nebenbei hat sie ihren beeindruckenden Debütroman “Fünf Kopeken” geschrieben, der in diesem Literaturherbst im Eichborn Verlag erschienen ist.