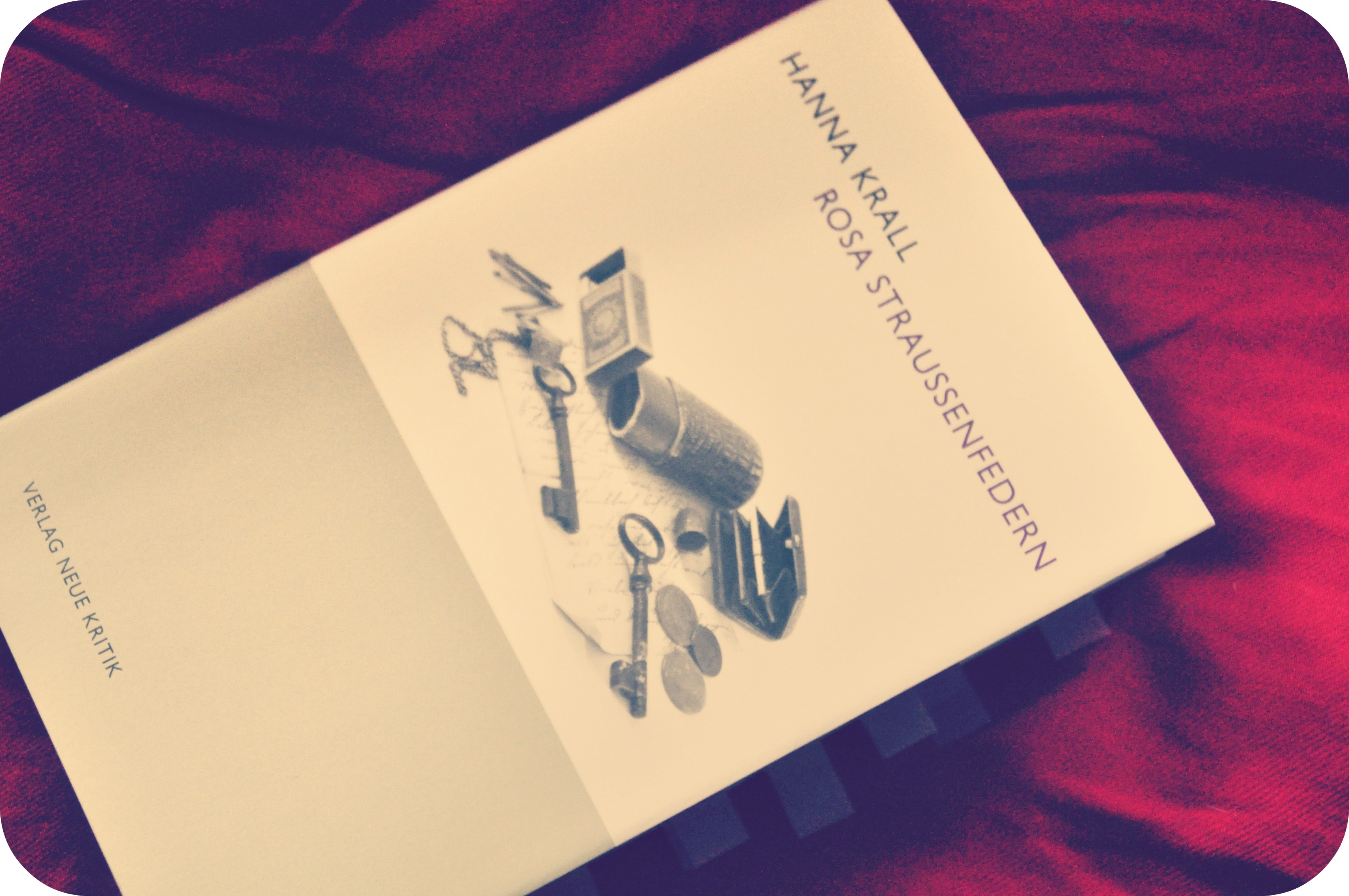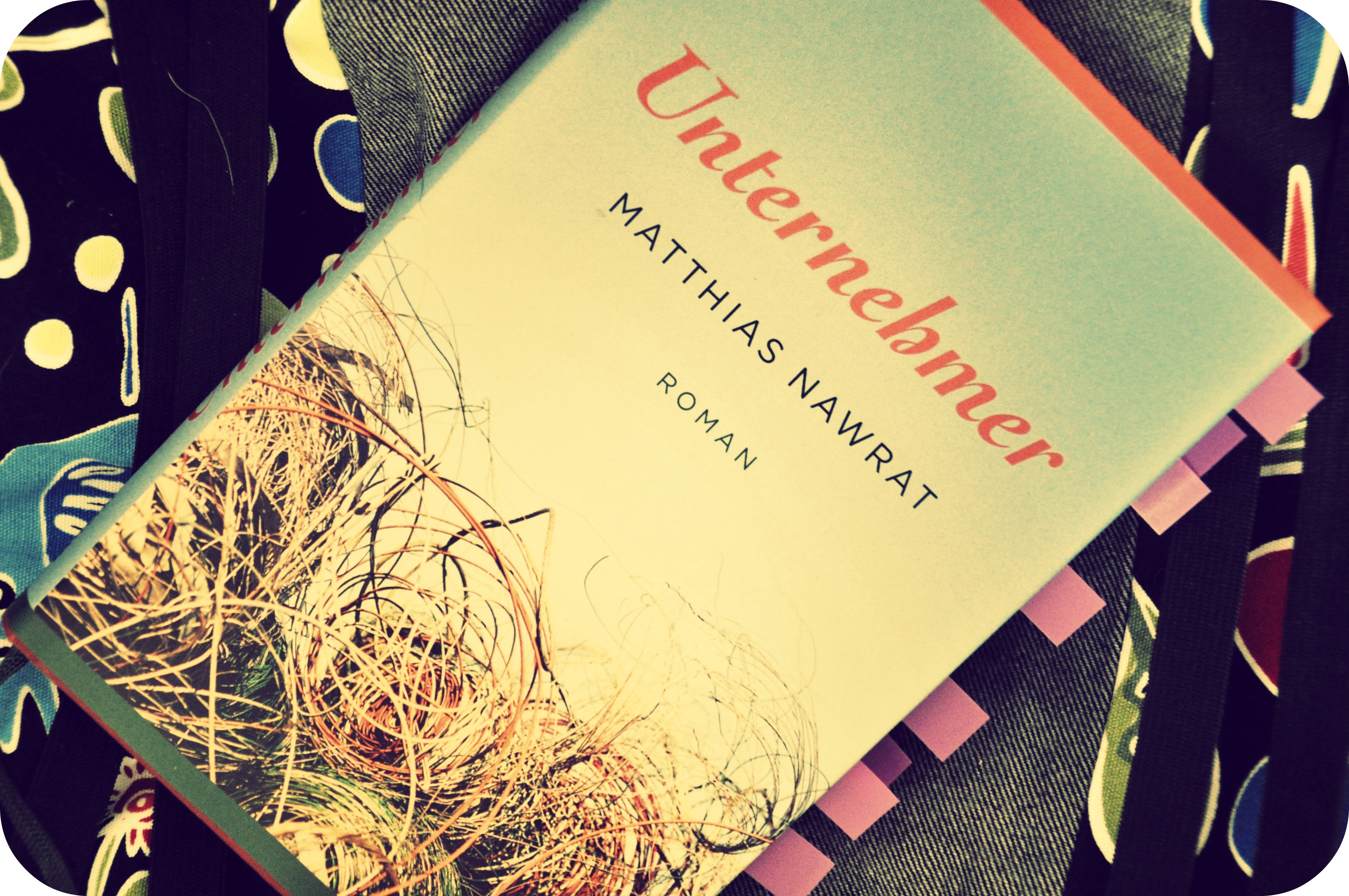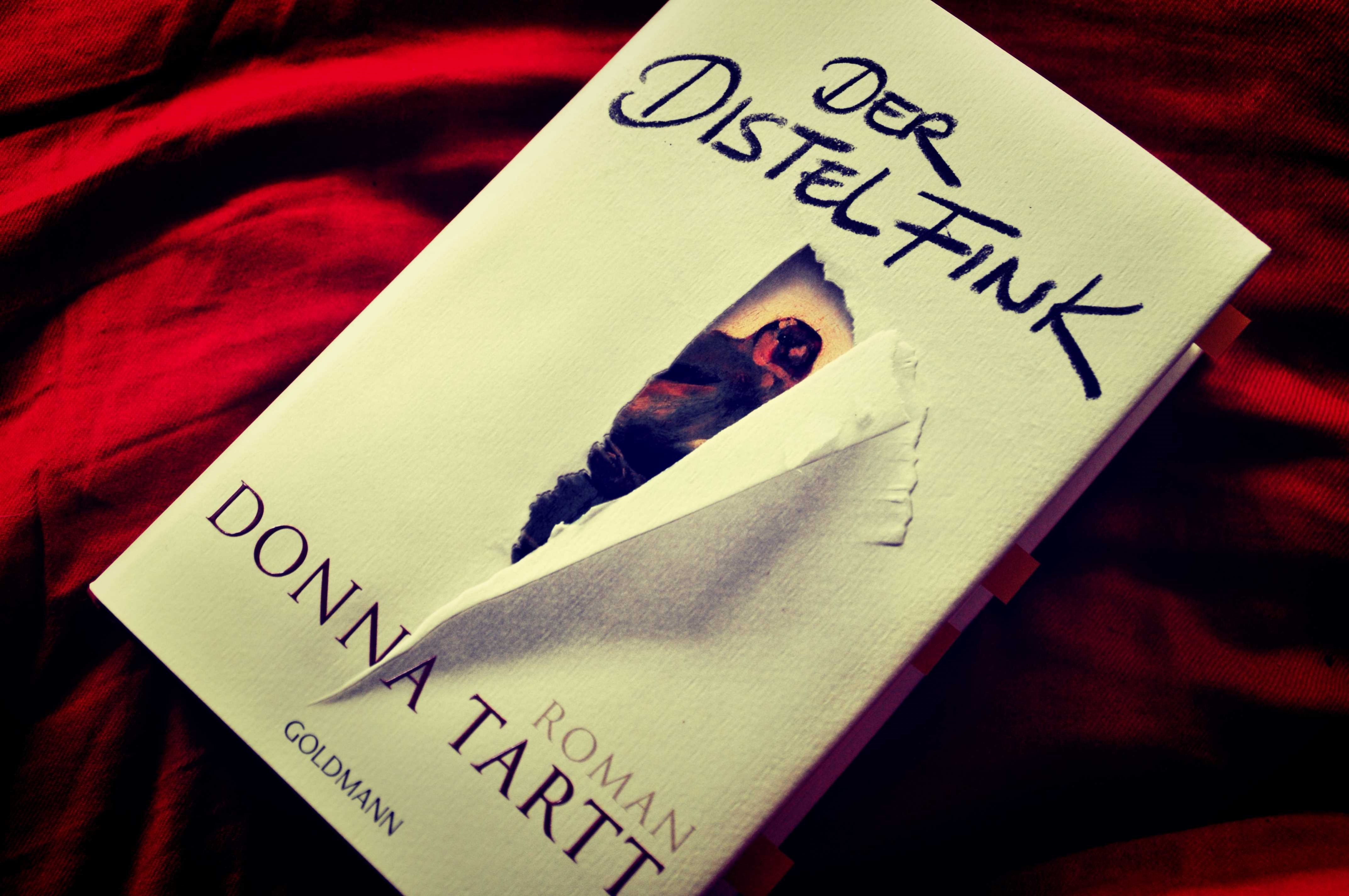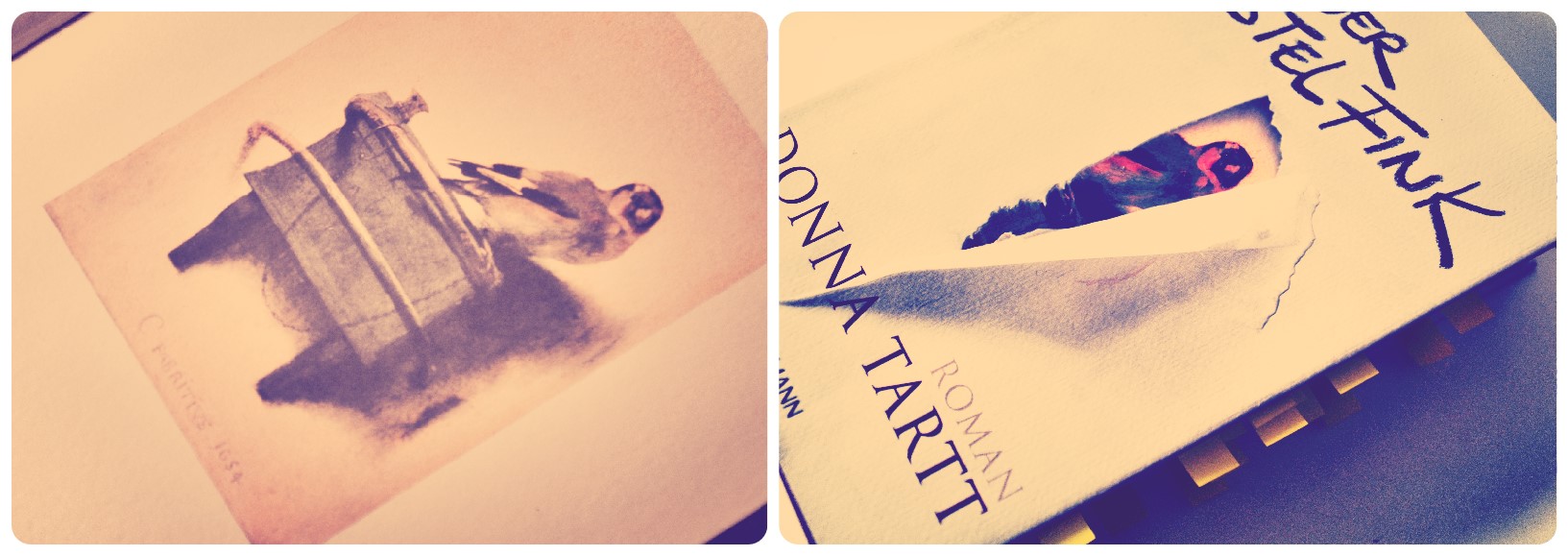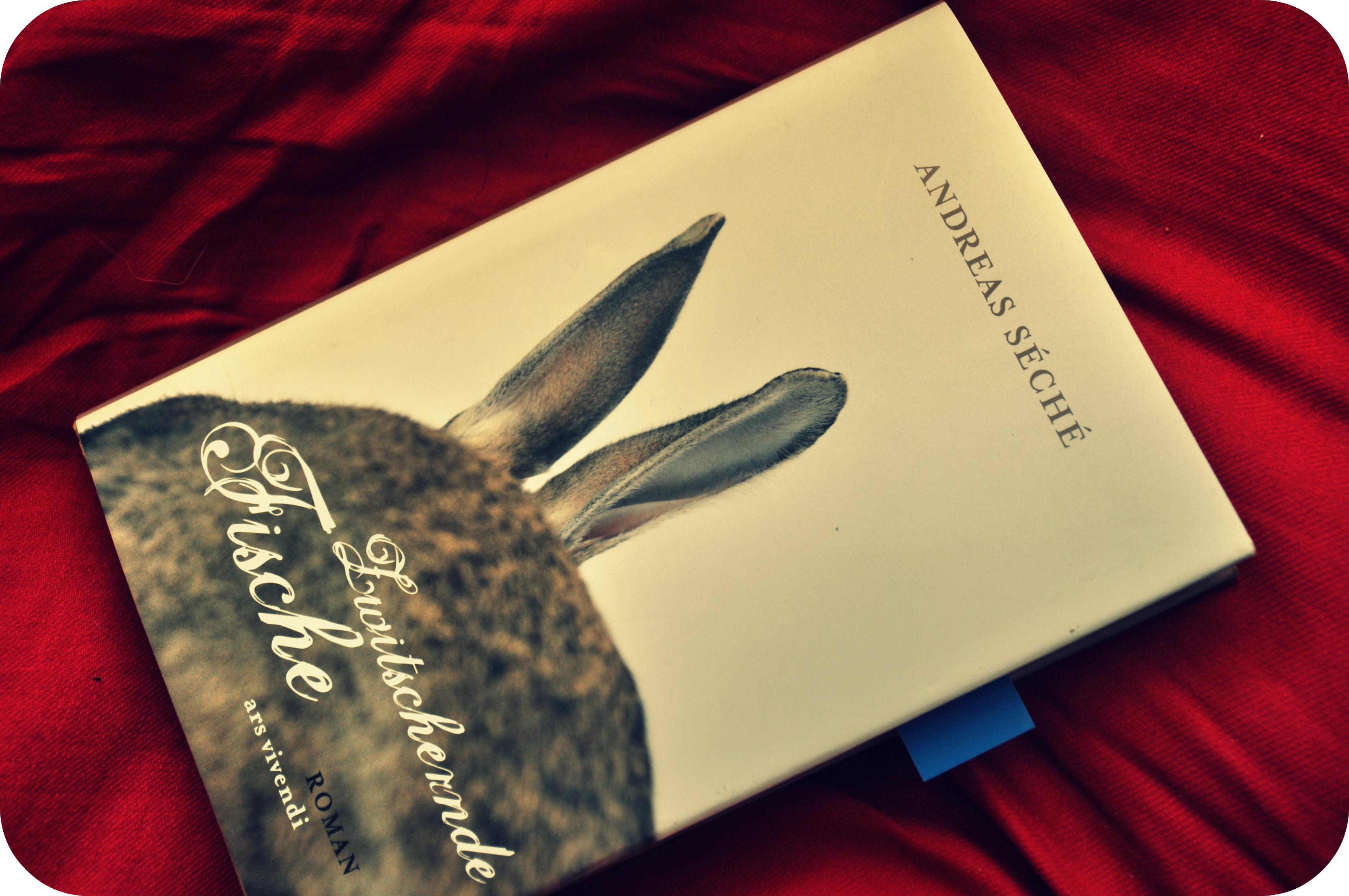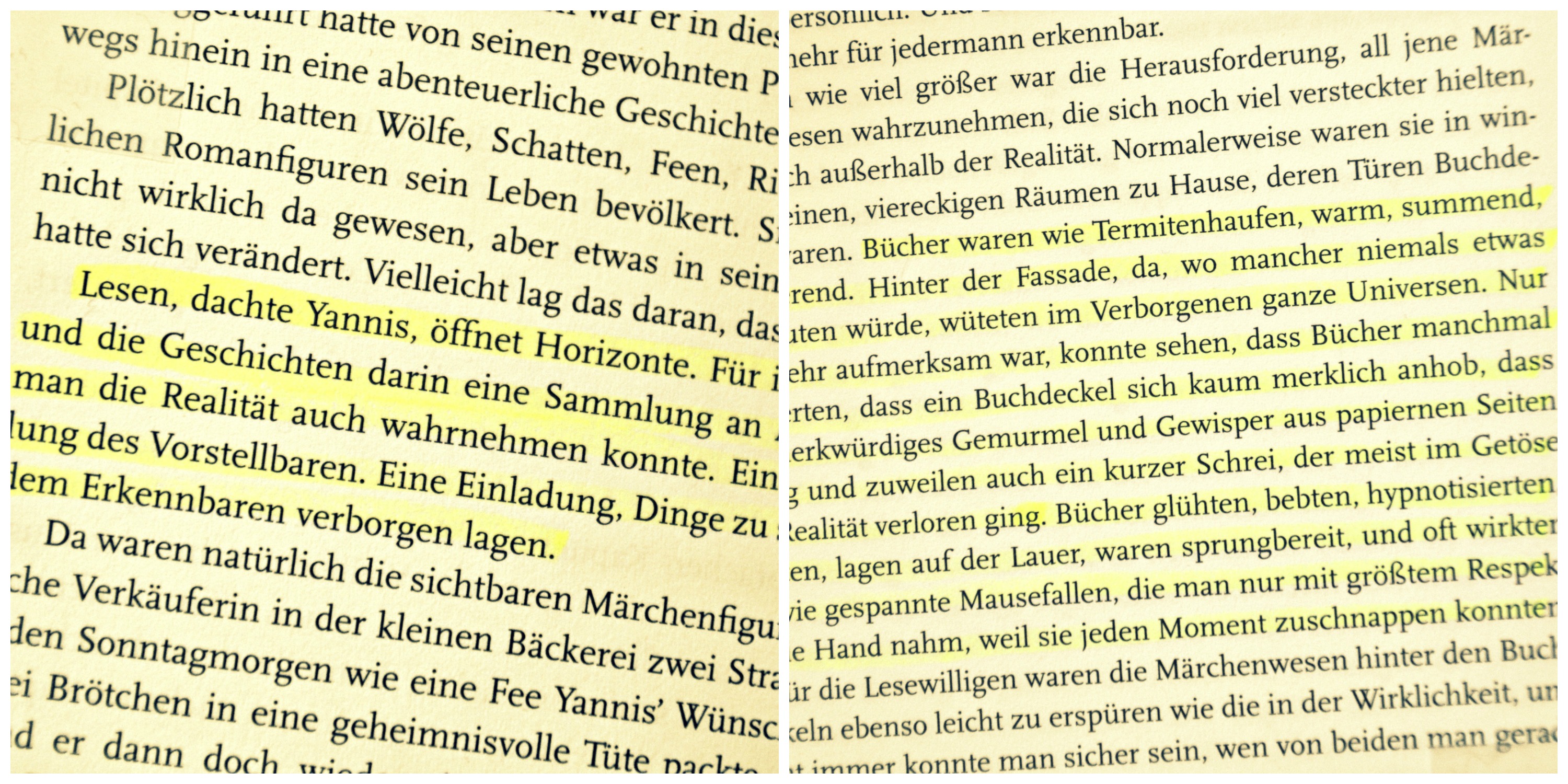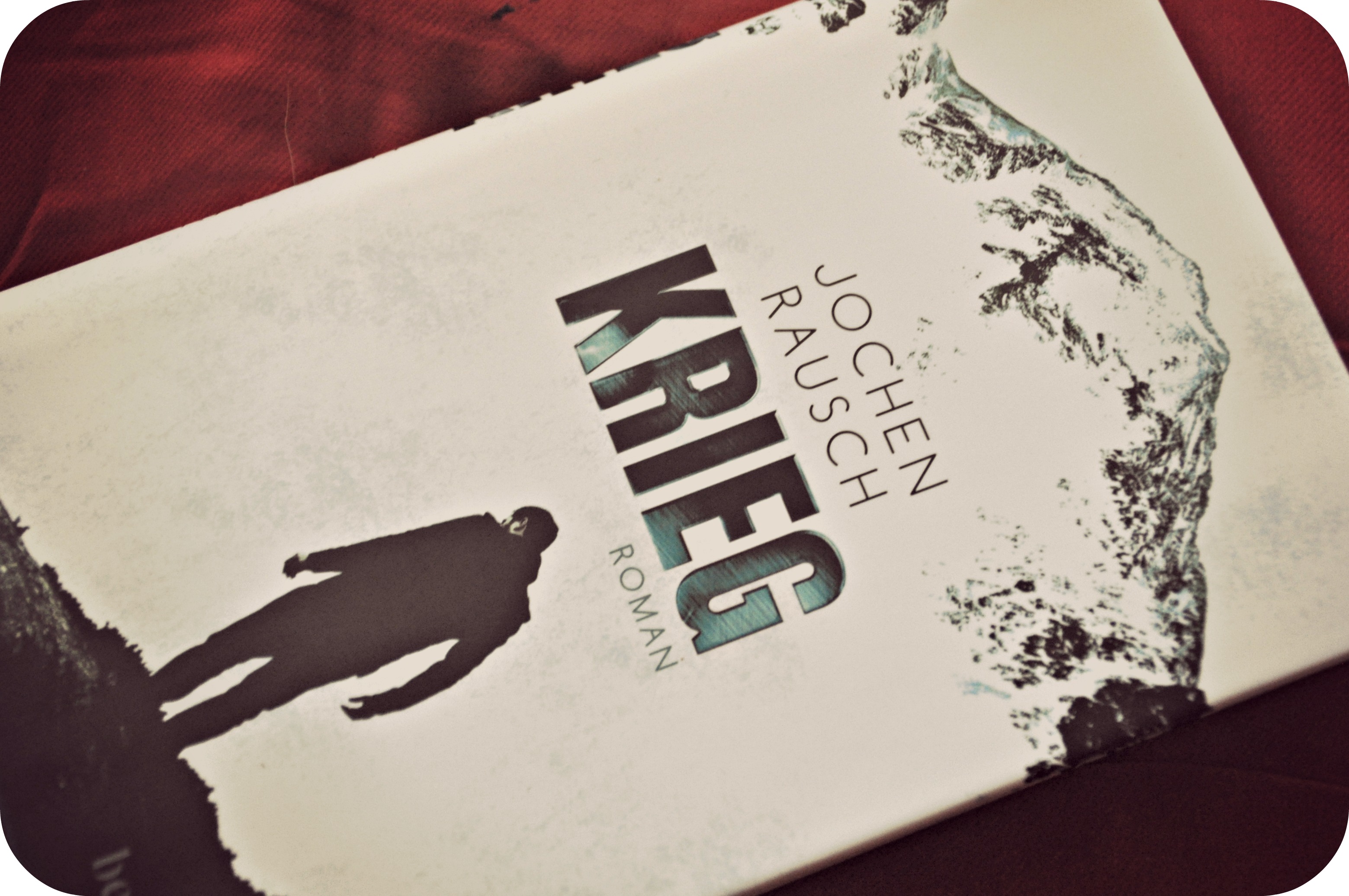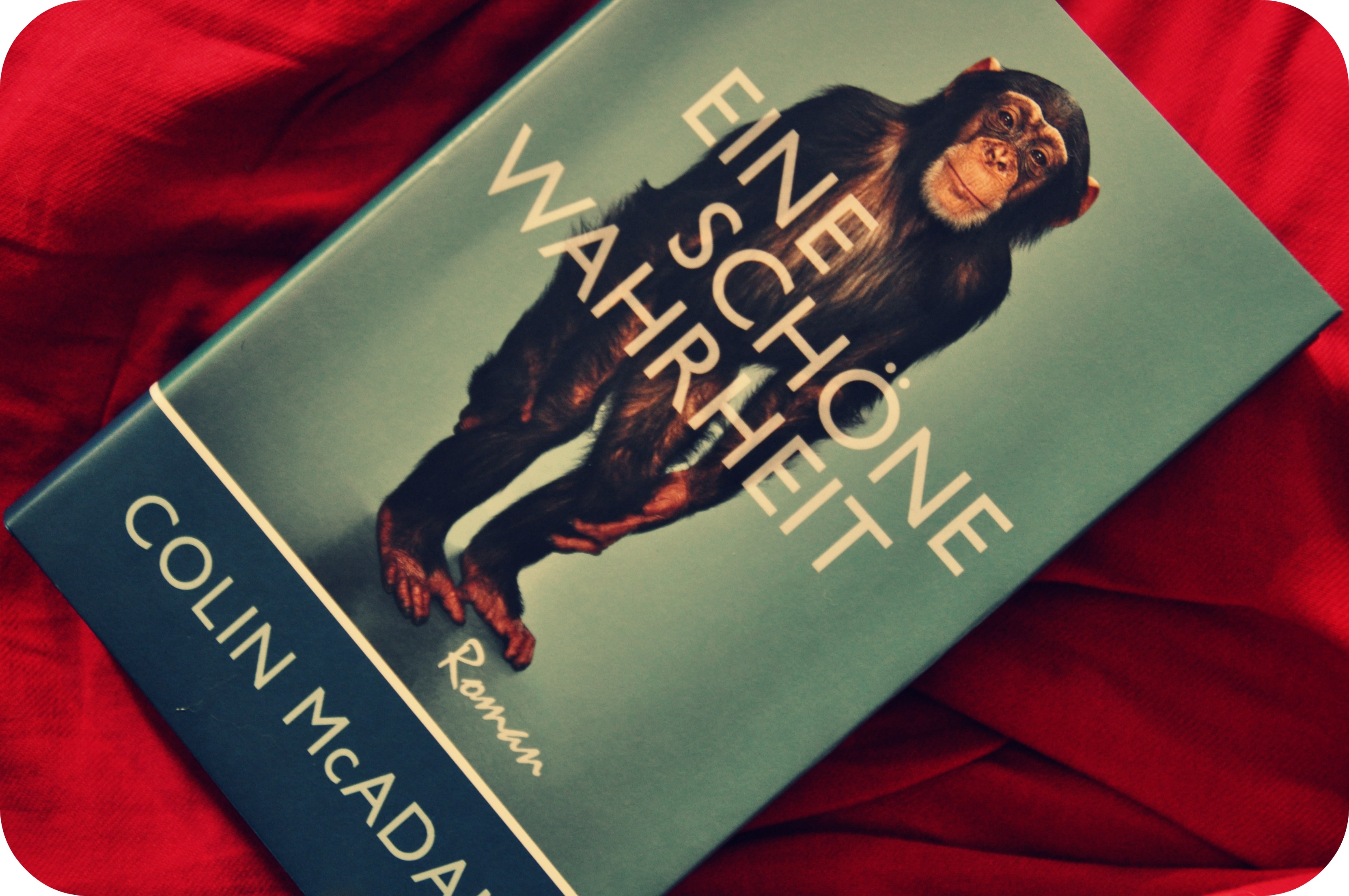“Dies ist ein Buch über das, was mir Menschen in fünfzig Jahren schrieben und erzählten.” Das sind die wenigen Worte, aus denen der Klappentext dieses seltsamen Buches besteht – es sind Worte, die mich sofort neugierig gemacht haben. Im Einband erfahre ich, dass Hanna Krall 1935 in Warschau geboren wurde und mit ihren Veröffentlichungen vor allem in Polen für Aufmerksamkeit sorgte, auch ein jahrelanges Publikationsverbot konnte sie nicht stoppen. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren häufig lakonischen Reportagen.
“Ich bin keine Pessimistin, überhaupt nicht. Ich denke nie, schade, dass ich nicht mehr vierzig bin. Ich denke, gut, dass ich noch nicht vierundsechzig bin. Ich denke, gut, dass ich eine Brasse gefangen habe und keinen Goldbarsch. Ich denke, dass mir solche Dinge wie Sonne, Wolken, Dämmerung am Wasser immer wichtiger werden.”
“Rosa Straußenfedern” ist weit entfernt von klassischer oder auch herkömmlicher Literatur, was auch immer man darunter verstehen mag. Es gibt keine Handlung, keine wirklichen Figuren, keinen roten Faden – das Einzige, das es gibt, ist ein klar abgegrenzter Zeitraum: die Jahre von 1960 bis 2009. Hanna Krall versammelt Briefe, Notizzettel, Gedankensplitter, Unterhaltungen, Ideen, Reportagematerial und ordnet all dies in eine chronologische Reihenfolge. Ihre Gesprächspartner sind berühmt, zu Wort kommt unter anderem Jan Karski, aber auch Marek Edelman. Doch es sind vor allem die unbekannten Stimmen, die unbekannten Namen, deren Geschichten berühren und bewegen.
Die Struktur des Buches ist kompliziert, ich habe mich beim Lesen zunächst einmal hineindenken müssen. Die einzelnen Abschnitte sind kurz, manchmal nur eine Seite lang, höchstens drei. Das Schriftbild ist zweigeteilt, die kursiven Passagen sind direkte Zitate ihrer Gesprächspartner, aus den anderen Stellen spricht die Stimme von Hanna Krall. Über jedem Abschnitt steht ein Name, es sind bekannte und unbekannte Namen – mit viel Gespür für das Detail und mit dem Auge einer Reporterin fasst Hanna Krall ihre Geschichten zusammen.
“Liebste Gattin, lass dich nicht unterkriegen, wir haben schon ganz andere Dinge überstanden, wir haben die Schwindsucht überstanden, die Wawel-Straße und den Verlust unserer Tulpenzwiebeln. Das Buch wird irgendwann herauskommen, das verspreche ich Dir. Vorerst gehe ich die Pferde unserer Tochter bezahlen und den dritten Band der Enzyklopädie kaufen. Ja, dein Buch ist fern, aber die Familie ist nah, vielleicht ist das gar nicht so schlecht.”
Der banale Alltag wechselt sich ab mit grausamen Erinnerungen an den Krieg. Krall ruft dem Leser alles der damaligen Zeit in Erinnerung: die Gewalt, die Grausamkeit, die Einsamkeit, der Hunger. Es gibt aber auch viele heitere und lakonische Abschnitte, wir erfahren woraus die Arbeit eines Sexers besteht, eine Berufsbezeichnung, über die ich zum ersten Mal gestolpert bin. Es wird ein Verlagsdirektor zitiert, der Hanna Kralls Buch ablehnt, Seite an Seite mit Briefen ihrer Tochter Katarzyna, die der Mutter aus dem Ferienlager schreibt. Auch mit der quälenden Frage der Berufswahl ihres Enkels, beschäftigt sich die Autorin.
Hanna Krall erzählt keine Geschichte, es bleibt dem Leser überlassen, die Geschichte, die sich in diesem 200 Seiten schmalen Buch verbirgt, aufzuspüren und zu entdecken. Die Geschichten der anderen, macht Hanna Krall zu ihrer eigenen, verleibt sie sich ein und erzählt sie nach. Der rote Faden ist – wenn man so mag – der Verlauf der Zeit. Hanna Krall richtet ihren Blick auf die großen sowie die kleinen Katastrophen unserer jüngsten Geschichte, sie lässt Holocaust-Überlebende zu Wort kommen und Solidarnosc-Aktivisten und wir lernen eine angebliche Attentäterin Lenins kennen.
“Ich bin überhaupt nicht melancholisch. Mir genügt eine kleine, winzige Freude am Tag. Mir genügt der Gedanke, dass diese Freude noch auf mich wartet. Manchmal ist es eine gute Zigarre. Manchmal … Sie werden es nicht glauben. Manchmal ein Stück Fruchtgelee – süß, mit Bitterschokolade überzogen -, das ich abends esse.”
Hanna Krall legt mit “Rosa Straußenfedern” ein wahrlich seltsames Buch vor. Ein Buch, das sich entzieht, das sich sperrt und verweigert – es ist nicht leicht, einen Zugang zu finden, zur Sprache von Hanna Krall, aber auch zu den hier versammelten Erinnerungen und Gedankensplittern. Und doch hat mich die Lektüre seltsam angerührt, all die Geschichten, Erinnerungen und Erlebnisse fremder und bekannter Menschen hallen auch jetzt immer noch in mir nach und ich ertappe mich dabei, wieder und wieder zu dem Buch zu greifen und in diese Lebensgeschichten einzutauchen.