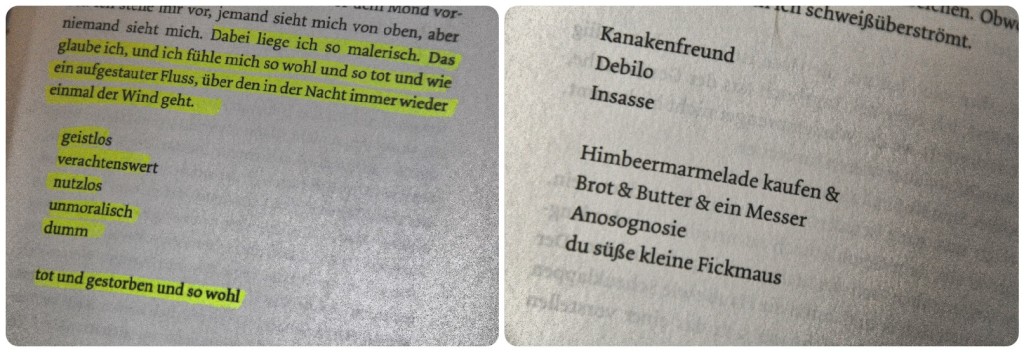Svenja Leiber erzählt eine Geschichte, die ganze vierundsechzig Jahre umspannt. Es ist eine Geschichte über das Leben und den Tod, über die Liebe, Leidenschaften und Begabungen, die Musik und unsere dunkle Vergangenheit. Es ist eine Geschichte voller Poesie und Musikalität, die vieles in sich vereint: Das letzte Land ist Bildungsroman, Familiengeschichte und Kriegsbuch in einem.
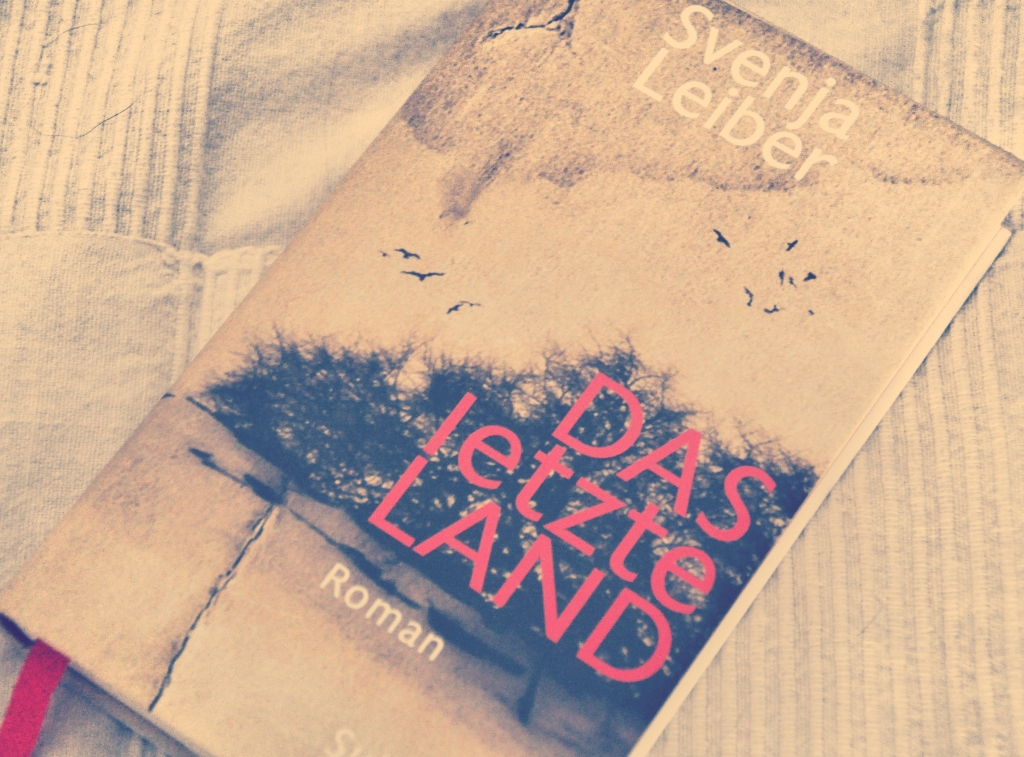
Die Geschichte, von der Svenja Leiber erzählt, beginnt im Jahr 1911: wir lernen Ruven Preuk kennen, den jüngsten Sohn des Stellmachers. Statt bei der täglichen Arbeit mit anzupacken, steht der sensible Junge häufig abseits und spinnt seine eigenen Gedanken. Ruven hat eine ganz besondere Begabung: er kann Töne sehen und seltsam schöne Melodien auf der Geige spielen. Im rauen Dorfalltag weiß kaum jemand etwas mit dem Jungen und dessen Begabung anzufangen. Es werden mutige und kräftige Männer gebraucht, die arbeiten und anpacken können, keine Träumer, die glauben Farben zu sehen, wenn sie Töne hören. Es ist ein Zufall, der ihm eine Geige schenkt, doch fortan musiziert der Junge und erhält Unterricht. Es dauert nicht lange und Ruven spielt besser als der Dorflehrer. Auf der Suche nach neuen Lehrern zieht es Ruven immer weiter fort: in der Stadt findet er einen neuen Lehrer. Bei dem Juden Goldbaum lernt er nicht nur seine Geige besser kennen, sondern verliebt sich auch noch in dessen Enkelin Rahel.
Ist ihm langsam ganz fern, dieser Junge. Kommt weder nach ihm noch nach der Mutter, und kam doch aber mal nach ihnen beiden. Er hatte die Formen von ihm und die Farben von ihr. Jetzt sieht es so aus, als habe er vor, einer zu werden, den man nicht kennt, jedenfalls sagte das neulich der Röver und guckte dabei nicht eben freundlich.
Eine Begabung, die in seinem Heimatdorf nicht erwünscht gewesen ist, die – wenn überhaupt – belächelt wurde, verspricht Ruven plötzlich Freiheit und Anerkennung. Auch wenn er seinem Zuhause weiterhin verhaftet bleibt, dringt er mit seiner Geige in der Hand in Gesellschaftsschichten vor, die eigentlich unerreichbar für ihn sind. Doch der Zweite Weltkrieg zerstört nicht nur Deutschland, sondern auch Ruvens Glauben an eine Karriere als Musiker.
[…] dann hat er nach ihrer Hand gegriffen, wie seit Jahren nicht, und sie hat gesagt, das sei eben das Schlimme am Muttersein, dass man seit der Geburt immer nur Abschied nehme. Auch Ruvcn nimmt Abschied, aber davon weiß er noch nichts, weil man mit neun immer nur weiß, dass was kommt, und darüber das Gehen nicht merkt. Das hat er seiner Mutter voraus. Er kann in jedem Moment vergessen, loslassen, wo sich was Neues breitmacht, genau wie sich jetzt das Fieber in Ruven breitmacht, oder die Zukunft.
Svenja Leiber begleitet ihre Figuren bis in das Jahr 1975 hinein: heraus aus dem bäuerlichen Dorf im hohen Norden, bis in die Großstadt nach Hamburg. Es sind 64 Jahre, während denen Ruven, der feinsinnige Junge mit der Geige, zu einem erwachsenen Mann reift – verheiratet ist und Nachwuchs bekommt. Alles könnte so schön sein, doch während Ruven den Ersten Weltkrieg noch unbeschadet übersteht, raubt der Zweite Weltkrieg ihm seine Karriere, seine Leidenschaft, sein Talent. Er wird eingezogen und muss das Musizieren aufgeben, als er nach Hause zurückkehrt, ist nichts mehr so, wie es zuvor gewesen ist. Er musiziert zwar noch, doch nie wieder so erfolgreich wie vor dem Krieg. Doch es nicht nur seine berufliche Laufbahn, die in einem schmerzhaften Prozess in zwei Teile bricht – auch seine Familie löst sich während des Krieges auf. Der Krieg löscht alles aus, löst alles auf, zerstört das, was zuvor gut gewesen ist.
Es ist nicht möglich, auf der Welt zu sein und keinen Vater zu haben. Es ist nicht denkbar. Man müsste verrückt werden, weil man weiterlebt, obwohl der, der immer schon lebte, der immer schon da war, lange vor einem selbst, und der für alles gesorgt hat, nicht mehr ist. Und die Liebe, die man doch für ihn hatte, die läuft jetzt immer ins Dunkle hinaus, als hätte man da irgendwo ein Leck.
Svenja Leiber entwirft in ihrem Roman nicht nur ein groß angelegtes Zeitpanorama, sondern auch eine weit verzweigte Familiengeschichte. Ihre Figuren begleitet sie über viele Jahrzehnte und behält dabei alle Erzählfäden kunstvoll in der Hand. Die Sprache ist etwas ganz Besonderes und wunderbar poetisch, auch wenn sich mancher Satz ungewöhnlich liest, verzaubern die Worte einen zugleich. Auch wenn “Das letzte Land” so viele Themen in sich vereint – zwei Weltkriege, eine große Familie, Tod und ganz viel Liebe – wirkt der Roman keineswegs überladen.
Das letzte Land ist einer der Romane dieses Jahr, die in dem Wust an Neuerscheinungen etwas untergegangen zu sein scheinen, doch diese Geschichte hat es verdient, entdeckt und gelesen zu werden und zwar von möglichst vielen!

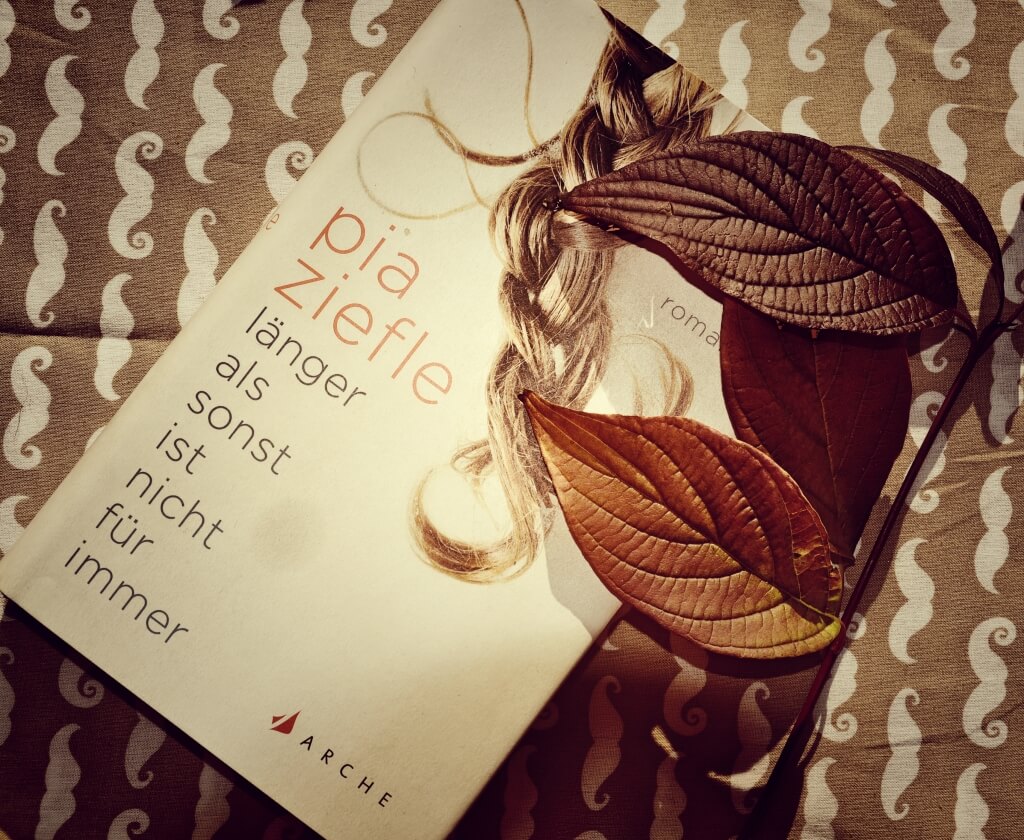
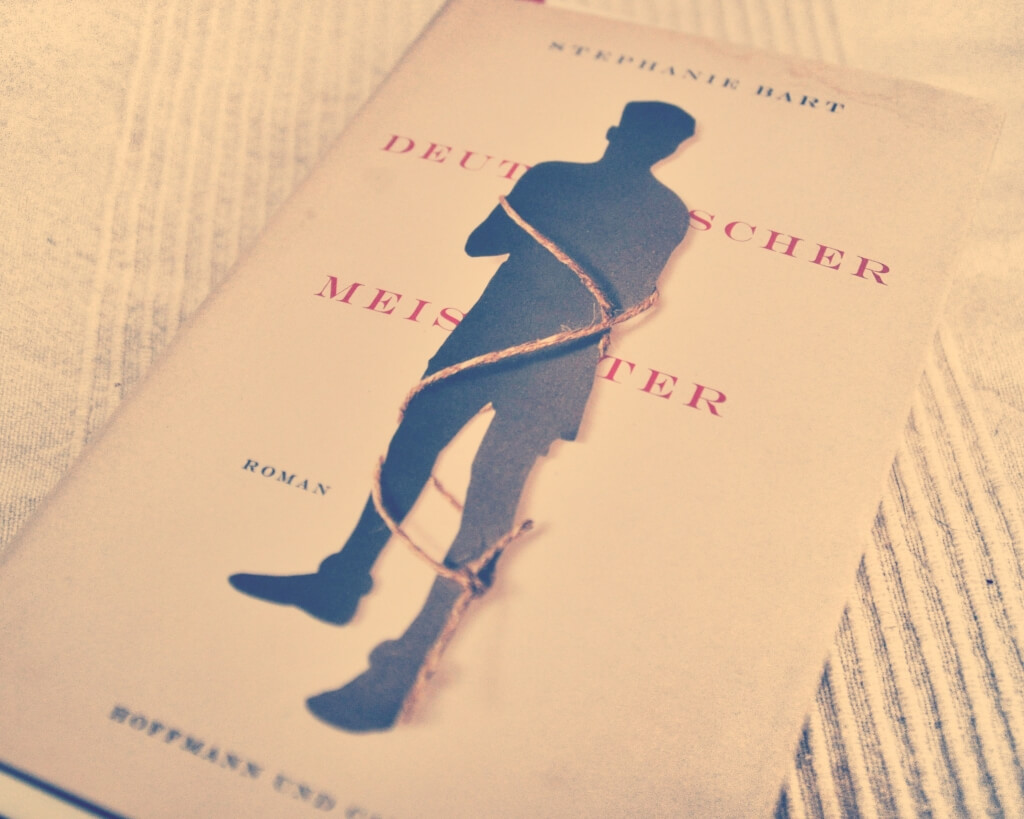 Es war der Kampf um den Titel des Deutschen Meisters im Halbschwergewicht am 9. Juni 1933 in der Bockbrauerei, Fidicinstraße, Berlin-Kreuzberg.
Es war der Kampf um den Titel des Deutschen Meisters im Halbschwergewicht am 9. Juni 1933 in der Bockbrauerei, Fidicinstraße, Berlin-Kreuzberg.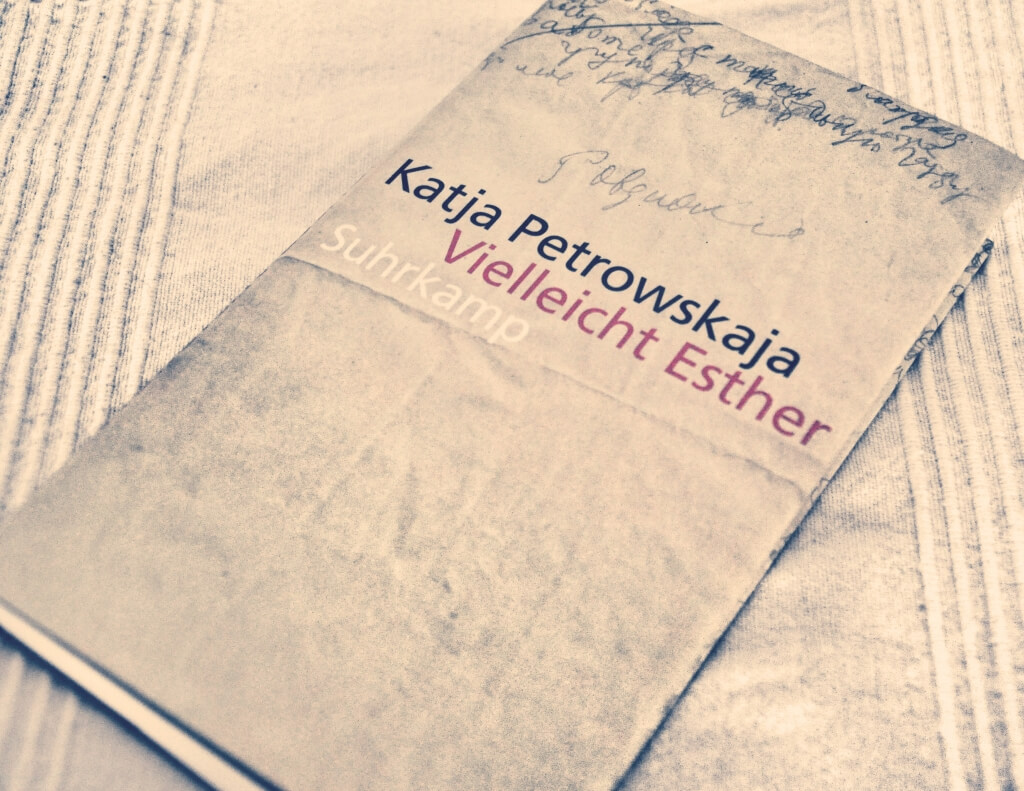
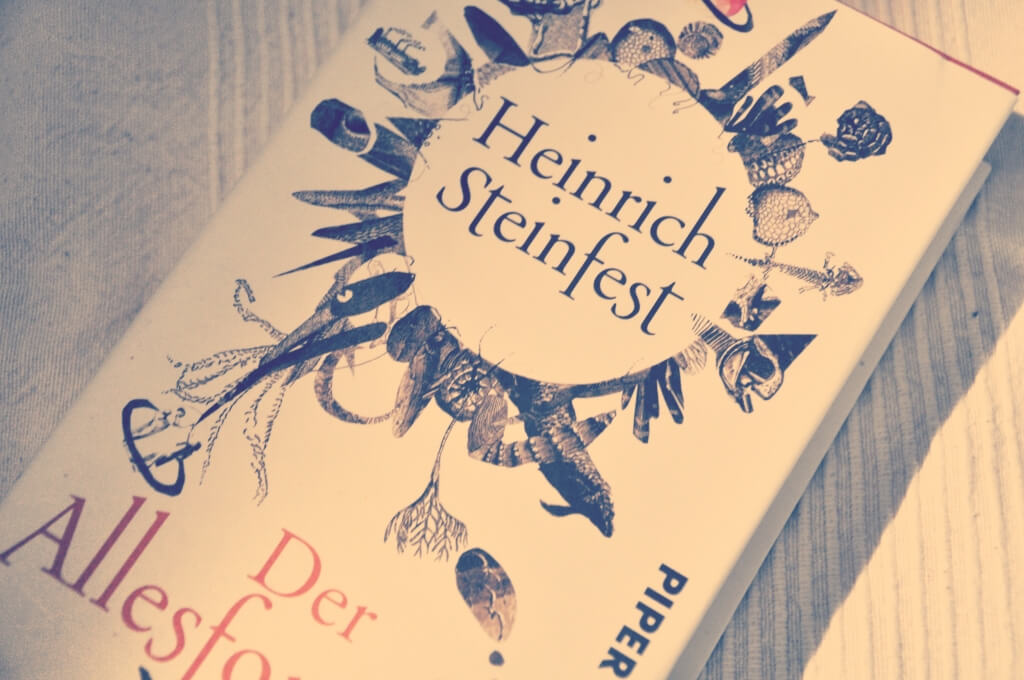 Der Beginn eines jeden Buchs leidet unter einem großen Manko: Es fehlt die Musik.
Der Beginn eines jeden Buchs leidet unter einem großen Manko: Es fehlt die Musik.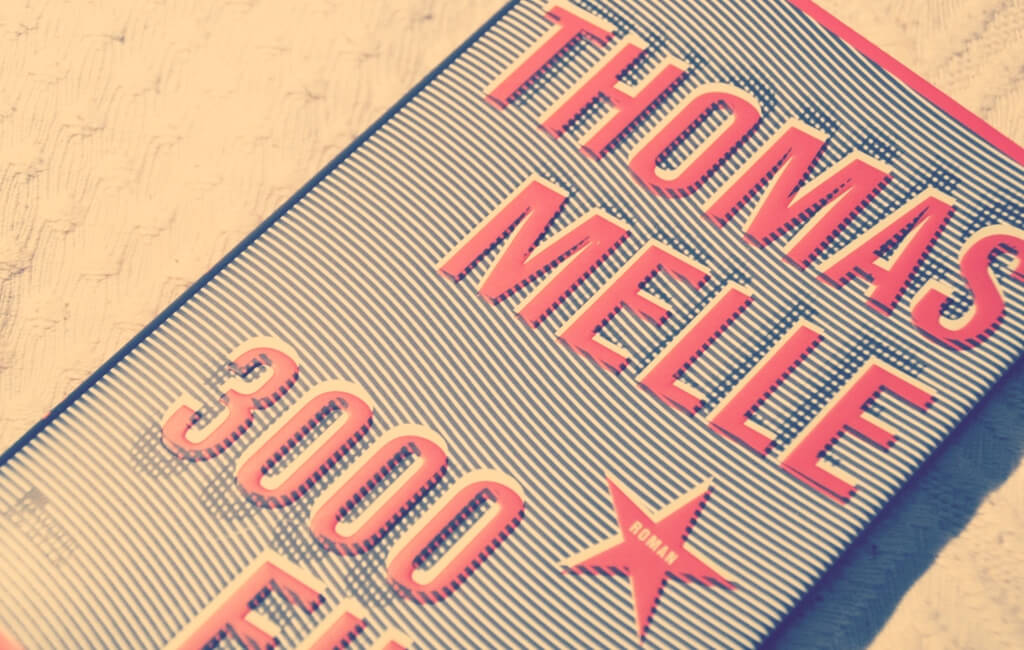
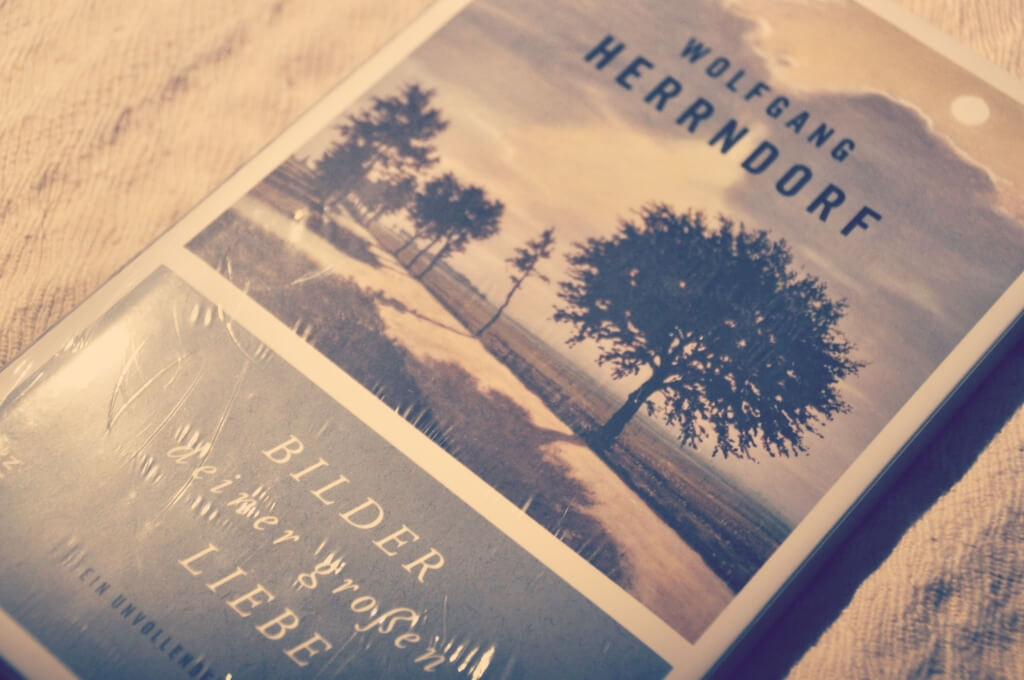 Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.
Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.