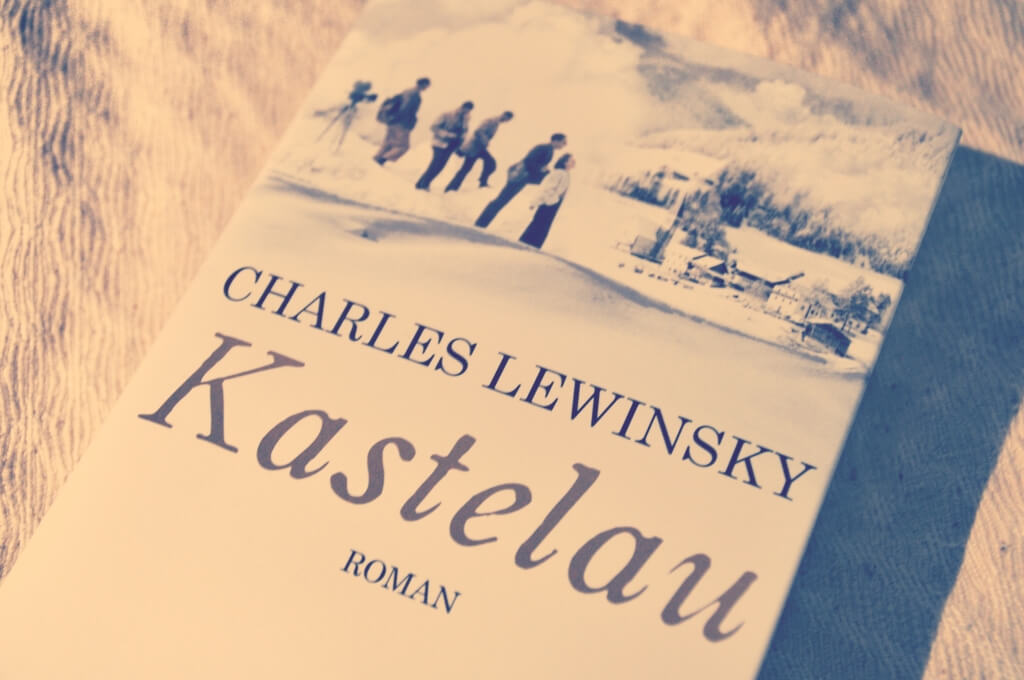Die finnische Schriftstellerin Raija Siekkinen erzählt in Wie Liebe entsteht eigentlich gar nicht vom Enstehen der Liebe, sondern viel mehr von ihrem Vergehen. Zehn Erzählungen beschäftigen sich mit dem Moment, in dem die Liebe erlischt, durch die Hintertür verschwindet. Getragen werden die Geschichten von einer leichten Schwere, von heller Düsterkeit.
Es gab die Zeit davor und die danach und das Einzige, was blieb, war weiterzumachen.
Wie Liebe entsteht ist ein schmales Bändchen. Gerade einmal knappe 160 Seiten umfassen die zehn Erzählungen, denen ein lesenswertes Nachwort des Schriftstellers David Wagner folgt. Allen Erzählungen gemein ist die Tatsache, dass Raija Siekkinen von Frauen erzählt. Frauen, die am Scheideweg stehen. Frauen, die Entscheidungen treffen müssen. Die Situationen, die die Autorin beschreibt, wirken wie aus dem Alltag gegriffen und doch haben all ihre Figuren etwas heldinnenhaftes an sich. Alltagsheldinnen.
Sobald alle Wünsche und Hoffnungen dahin sind, dachte Anna, hat der Mensch eine Grenze überquert und schüttelt auf der anderen Seite den Kopf über seine Taten und Motive, löst sich schließlich. Dann folgt die Beerdigung.
Die Titelgeschichte erzählt von einer Frau, die plötzlich erkennen muss, dass sie schon lange nicht mehr jung ist und der große Teil ihres Lebens bereits vorbei ist. Es gibt nichts mehr im Leben, das sie festhalten möchte, auch ihren Mann liebt sie schon lange nicht mehr. Der Tag, an dem sie dies erkennt, ist ausgerechnet der Tag, an dem ihr Mann ihr seine immer noch andauernde Liebe erklärt. In einer anderen Geschichte fragt ein Mann seine Freundin: Sollen wir nicht doch heiraten? Die ganze Erzählung kreist um diese fünf Worte, die so dahin gesagt sind und doch ein ungeheuer schweres Gewicht haben. Könnte es eine lieblosere Liebeserklärung geben?
An einem Abend ging ich danach noch hinaus, spazierte durch den Schnee und sah zu unserem Haus, dessen Fenster hell leuchteten, und dachte, dass ich in meinem eigenen Leben feststeckte und es keinen anderen Ort gab, an den ich gehen konnte. Ich kehre in meinen Fußstapfen zurück, an der Tür kam mir die Wärme entgegen.
Alle zehn Geschichten, die von Elina Kritzokat hervorragend ins Deutsche übertragen wurden, erzählen von einem Vergehen. Liebe entsteht nicht, Liebe vergeht, doch dafür ensteht vielleicht etwas Neues: eine Freiheit, ein neues Leben, ein Aufbruch in eine neue Zukunft. Das Entstehen und Vergehen spiegelt sich in den Geschichten wider: in fast allen von ihnen spielen Renovierungsarbeiten eine Rolle – etwas Altes vergeht, etwas Neues entsteht. Die Protagonistinnen von Raija Siekkinen stecken fest, empfinden ihr Leben als Falle – alle Illusionen haben sie schon lange verloren, die Liebe fühlt sich für die meisten von ihnen nur noch schal an.
Die Geschichten haben den Charakter eines Kammerspiels. Beim Lesen habe ich das Gefühl, durch die finnische Landschaft zu laufen: die Sonne scheint vom Himmel, doch es ist eisig kalt und eine Schneedecke begräbt alles Lebendige unter sich. Raija Siekkinen verliert nicht viele Worte über ihre Figuren, über die Handlung ihrer Geschichten und doch entfalten diese beim Lesen eine ungeheure Wucht. Worte, die so luftig und lockerleicht daher kommen, besitzen plötzlich eine erschreckende Schwere. Die Autorin macht Worte schwer, gibt Sätzen Gewicht und beschreibt dabei einen in seiner Alltäglichkeit schier bedrückenden Alltag.
Ja, suchten nicht alle Menschen ihr Leben nach diesen Einheiten ab, nach Anfängen und Enden, teilten ihre Zeit in Episoden ein, in denen sie immer eine neue Hauptfigur waren? Auch sie hatte Phasen abgeschlossen und zugeklappt wie ein vollgeschriebenes Tagebuch, das man nie wieder las, höchstens kurz durchblätterte, ehe man es verbrannte. Aber dann war ihr alles wieder aufs Neue begegnet, und sie hatte begriffen, dass so das Leben beschaffen war.
Selten zuvor habe ich Erzählungen gelesen, die auf so wenig Seiten so viel Wucht entfalten, so viel Schwere und Traurigkeit und all das mit einer ungeheuren Leichtigkeit. David Wagner beschreibt sie in seinem Nachwort als leicht-schwer und so verzweifelt und ich möchte mich ihm eigentlich nur noch anschließen. Ja, leicht-Schwer und verzweifelt und doch sind die Geschichten mit so viel Offenheit geschrieben, dass ich als Leserin die einzelnen Fäden nehmen und damit meine eigenen Geschichten spinnen kann.

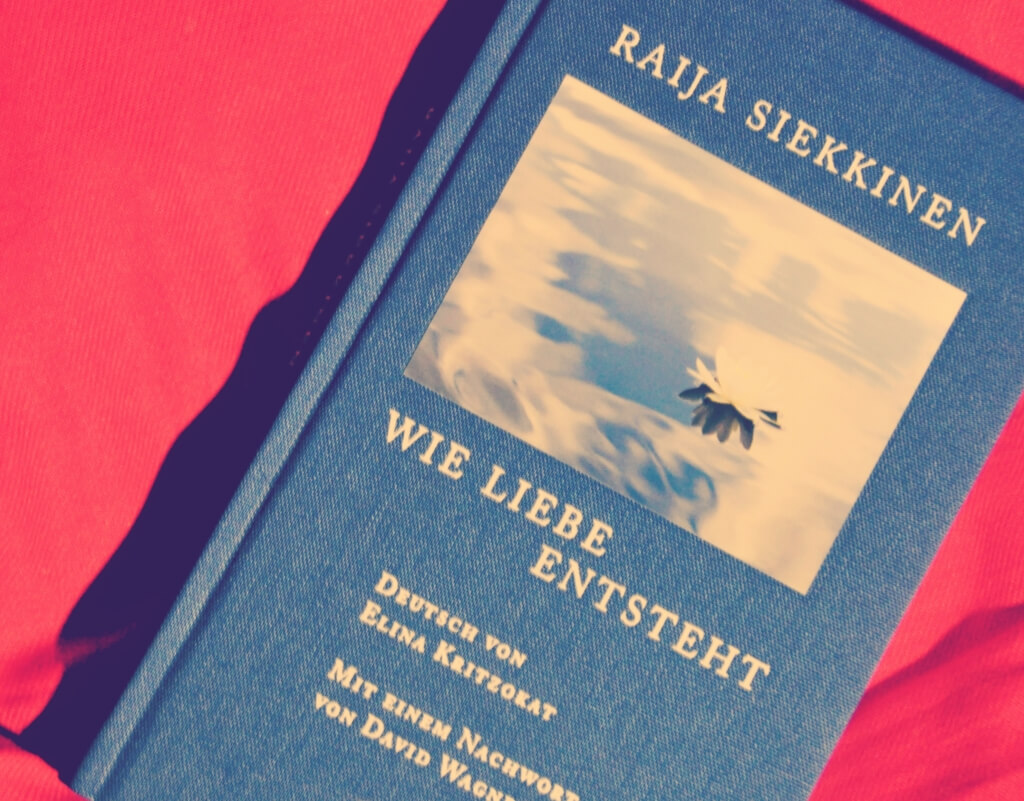
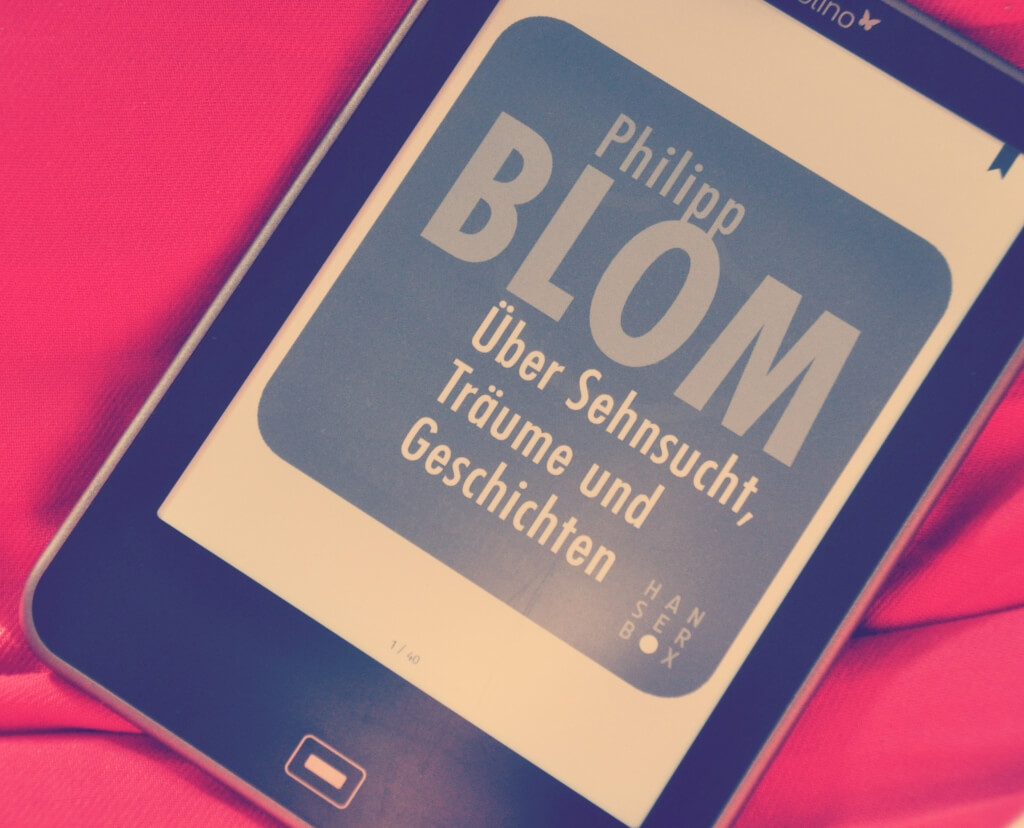
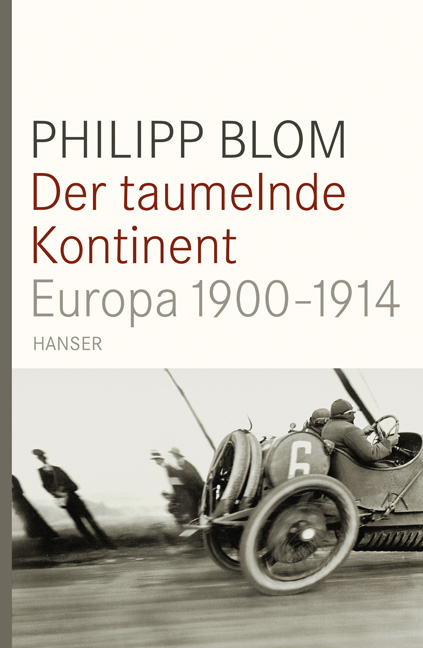
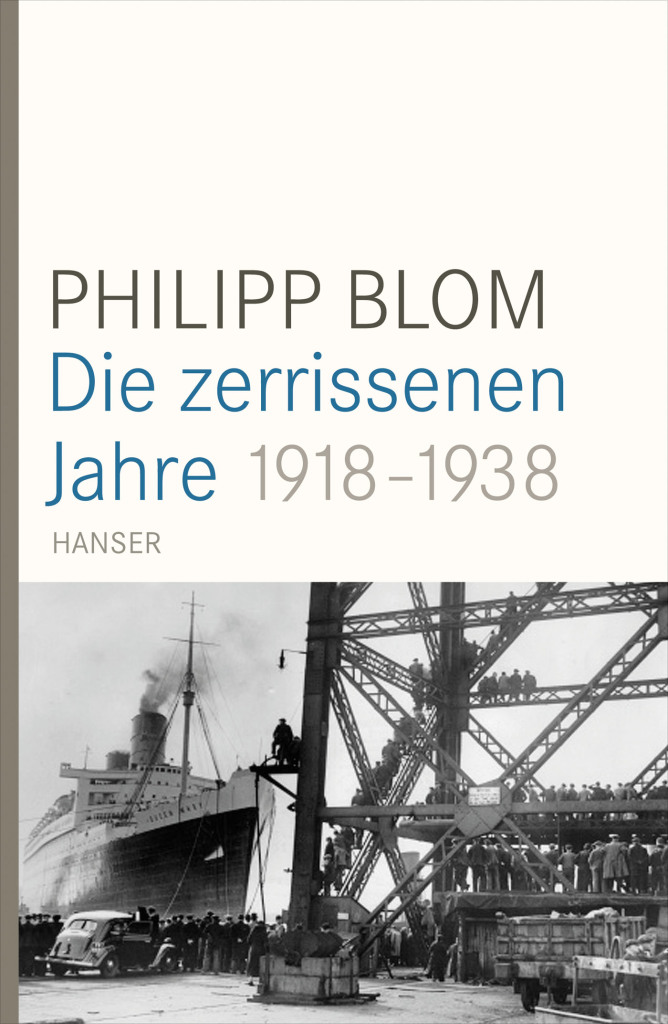
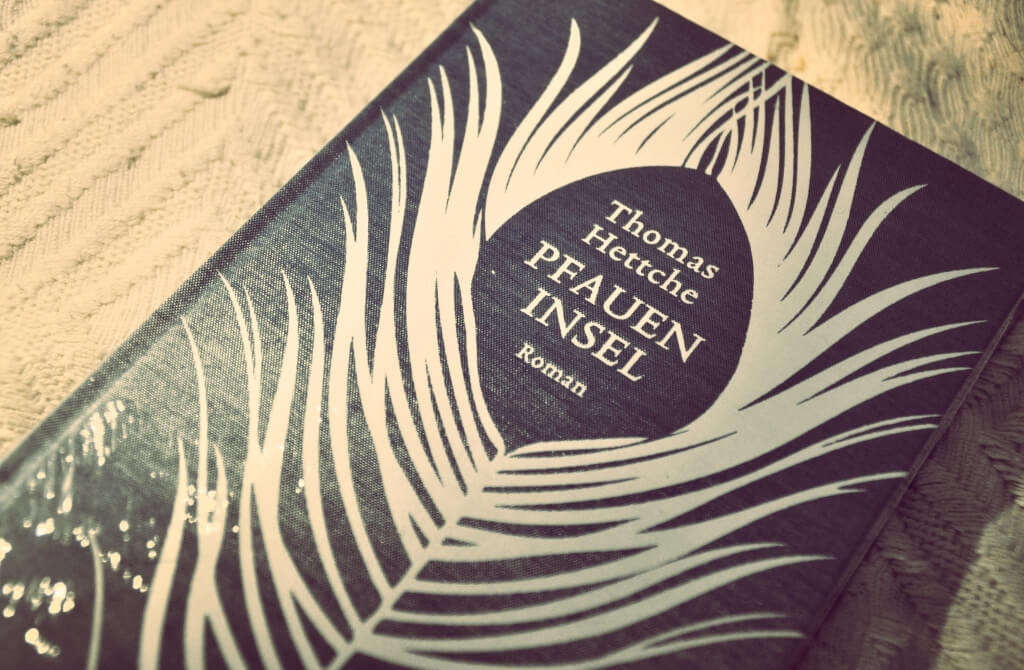 Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.
Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.