 1981 wurde Lena Gorelik im heutigen St. Petersburg geboren, 1992 zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Debütroman “Meine weißen Nächte” erschien bereits 2004, mit ihrem zweiten Roman “Hochzeit in Jerusalem” wurde die Autorin für den Deutschen Buchpreis nominiert. In diesem Literaturherbst erscheint mit “Die Listensammlerin” nun endlich ein weiterer Roman von Lena Gorelik.
1981 wurde Lena Gorelik im heutigen St. Petersburg geboren, 1992 zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Debütroman “Meine weißen Nächte” erschien bereits 2004, mit ihrem zweiten Roman “Hochzeit in Jerusalem” wurde die Autorin für den Deutschen Buchpreis nominiert. In diesem Literaturherbst erscheint mit “Die Listensammlerin” nun endlich ein weiterer Roman von Lena Gorelik.
“Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst. Großmutter hatte das einmal gesagt, als faktischen Nebensatz fallenlassen, nicht mit der Schulter gezuckt, keine Pause gemacht, einmal, als sie vom Krieg sprach.”
Im Zentrum von Lena Goreliks neuem Roman “Die Listensammlerin” steht Sofia. Sofia befindet sich in einer Phase der heillosen Überforderung. An die neue und ungewohnte Rolle als Mutter hat sie sich immer noch nicht gewöhnen können und dann hat ihre kleine Tochter Anna auch noch einen Herzfehler. Die lebensrettende Operation steht kurz bevor. Ehemann Florian, der von Sofia immer nur Flox genannt wird, ist nur bedingt eine Hilfe. Auch ihre eigene Mutter ist ihr keine Unterstützung, genauso wie ihre Großmutter, die an Demenz erkrankt in einem Pflegeheim lebt. Das einzige, was Sofia in dieser Situation hilft, häufig zum Unverständnis ihrer Mitmenschen, sind ihre Listen. Ihre Leidenschaft, zu allen möglichen Themen, Listen anzulegen, ist für Sofia eine Form der Beruhigung.
“Ich habe eine Liste mit Büchern, die mich zum Weinen gebracht haben, eine mit Büchern, die mich zum Lachen gebracht haben, eine Liste mit Büchern, die ich besser nicht gelesen hätte, eine mit Büchern, die ich noch einmal lesen will. Eine mit Büchern, die noch geschrieben werden müssen, eine mit Büchern, die ich gerne schreiben möchte.”
Ein Zettel und ein Stift und Dinge, die man in lange Listen ordnen kann – mehr braucht sie nicht, um zur Ruhe zu kommen, klare Gedanken zu fassen und wieder Kraft zu schöpfen.
“Die Listen gaben mir Kraft und Ruhe wie anderen das Gebet, Alkohol, Drogen, ein Therapeut, die Zigaretten und das Shoppen. Ich wusste, dass sowohl Drogen wie auch Psychotherapeuten gesellschaftlich weit anerkannter sind als Listen. Aber Listen, zumal solche Listen, sind rar, außer mir schreibt meines Wissens niemand so viele Liste, niemand ordnet, niemand pflegt sie. Es ist also in Ordnung, seinem Körper in gewissem Maße Alkohol und Nikotin zuzuführen, um abzuschalten oder auf andere Gedanken zu kommen. Aber jemand, der zu seiner Beruhigung und inneren Ausgeglichenheit nichts weiter als ein Blatt Papier und einen Stift braucht, gilt als sonderbar.”
Sofia, die Listenschreiberin und -sammlerin, glaubt lange daran, dass sie alleine ist mit diesen Leidenschaft. Welcher andere Mensch schreibt schon Listen, während er darauf wartet, dass die Tochter, die gerade am Herzen operiert wird, aus dem OP-Saal kommt? Die Listen haben Sofia bereits zu einem Therapeuten geführt, wo sie von ihrer besorgten Mutter hingeschickt wurde und auch mit Flox gab es wegen ihnen schon einige fürchterliche Streits. Doch dann macht Sofia in der Wohnung ihrer Großmutter eine überraschende Entdeckung: eine Sammlung von Listen, notiert in vergilbte Hefte und auf Notizzetteln, verfasst in kyrillischer Schrift. Die Schrift ist ein Hinweis auf die Herkunft von Sofias Familie, die die Sowjetuninion in den siebziger Jahren verließ – doch der Verfasser der Listen ist zunächst unbekannt. Doch Sofia findet nicht nur die Listen, sondern auch einen Hinweis auf einen gewissen Onkel Grischa, es ist ein Onkel, der aus dem Familiengedächtnis gelöscht und aus der Vergangenheit gestrichen wurde – gesprochen wurde über ihn nicht. “Er war eben der allseits beliebte, etwas sonderbare und verrückte, niemals erwachsene Märchenonkel.” Es sind die Listen, die Sofia das Gefühl geben, nicht alleine zu sein und durch die sie der bewegten Geschichte Grischas auf die Spur kommt. Es ist eine Geschichte, die im Untergrund spielt und die von einem ganz besonderen jungen Mann erzählt, der allen in seiner Familie Angst machte und doch sehr geliebt wurde. Mithilfe von Onkel Grischa, der Kopf einer Dissendentenbewegung in der Sowjetunion gewesen ist, taucht der Leser ab in eine Vergangenheit, die geprägt gewesen ist vom Widerstand, vom Untergrund und von Autoren, Künstlern und Wissenschaftlern.
“Nähme man Michel aus Lönneberga, Emil Tischbein und seine Detektive und Max und Moritz zusammen, hätte Onkel Grischa sie problemlos übertrumpft. Vier gebrochene Knochen, eine gebrochene Nase, mindestens siebenundvierzig dicke Beulen, eine Schramme auf der Stirn quer über der rechten Augenbraue, eine zehn Zentimeter lange am linken Schienbein, ein zickzackiges Brandmal auf der rechten Hand – und das alles schon vor dem ersten Schultag.”
Lena Gorelik lässt zwei Erzählstränge nebeneinander herlaufen und erzählt abwechselnd von Sofias Gegenwart und Grischas Vergangenheit. Voneinander abgegrenzt werden sie durch typographische Merkmalen. Es ist gerade auch bedingt durch dieses abwechselnde Erzählen, dass es der Autorin wunderbar gelingt aufzuzeigen, wie stark Gegenwart und Vergangenheit miteinander verschränkt sind. Grischas Geschichte liegt bereits viele Jahre zurück, von der Familie wurde sie ausgeklammert, beschönigt oder verschwiegen. Doch gut gegangen ist es niemanden mit diesem Schweigen, denn das Schweigen saß wie ein Knoten im Hals, der die Luft zum Atmen abschnürt. Sofia hat Grischa nie kennengelernt, aber durch den Blick in seine Vergangenheit erfährt sie gleichzeitig etwas über die Vergangenheit ihres Vaters, von dem sie immer annahm, dass er bei einem Autounfall starb, als sie sieben Monate alt war. Erst, wenn man bereit ist, nicht mehr zu schweigen, sondern zu sprechen, kann es gelingen, mit einer schwierigen Vergangenheit leichter umzugehen. Lena Gorelik gelingt es mit sehr viel Sensibilität und einer feinen Beobachtungsgabe aufzuzeigen, wie stark die Vergangenheit die Gegenwart einer ganzen Familie prägen kann.
Das Cover und der Titel des Romans suggerieren in ihrem Zusammenspiel einen heiter bis lustigen und unterhaltsamen Roman. Der Roman, oh ja, ist auch stellenweise von einer sanften Komik. Es gibt viele Passagen, über die ich schmunzeln musste. Dazu trägt vor allem Sofia bei, mit ihren liebenswerten Marotten und ihren Schwierigkeiten sich in die neue Rolle als Mutter hineinzufinden. Doch “Die Listensammlerin” ist kein leichter Roman, ganz im Gegenteil: Lena Gorelik hat einen schmerzhaft traurigen Roman geschrieben, durchzogen mit schwermütiger Melancholie und einem feinen Witz. Es ist ein großartiger und sehr lesenswerter Roman.

 Malin Schwerdtfeger, die 1972 geboren wurde, ist in Bremen aufgewachsen. Sie studierte Judaistik und Islamwissenschaft und arbeitete in einer Berliner Buchhandlung – heutzutage lebt sie als Schriftstellerin in eben dieser Stadt. Mit “Café Saratoga” debütierte die Autorin 2001 und wurde von der Kritik begeistert gefeiert. Erschienen ist das Buch nun erneut und zwar in der
Malin Schwerdtfeger, die 1972 geboren wurde, ist in Bremen aufgewachsen. Sie studierte Judaistik und Islamwissenschaft und arbeitete in einer Berliner Buchhandlung – heutzutage lebt sie als Schriftstellerin in eben dieser Stadt. Mit “Café Saratoga” debütierte die Autorin 2001 und wurde von der Kritik begeistert gefeiert. Erschienen ist das Buch nun erneut und zwar in der  Angelika Overath, die 1957 in Karlsruhe geboren wurde, arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin, Dozentin und Schriftstellerin. Bisher hat sie bereits zwei Romane veröffentlicht, mit dem Buch “Flughafenfische” wurde die Autorin sowohl für den Deutschen als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Angelika Overath lebt heutzutage in Sent, Graubünden.
Angelika Overath, die 1957 in Karlsruhe geboren wurde, arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin, Dozentin und Schriftstellerin. Bisher hat sie bereits zwei Romane veröffentlicht, mit dem Buch “Flughafenfische” wurde die Autorin sowohl für den Deutschen als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Angelika Overath lebt heutzutage in Sent, Graubünden. Die 1962 in Ellwangen geborene Beate Rothmaier studierte deutsche und französische Literatur und lebt heutzutage als freie Autorin in Zürich. Im Jahr 2005 debütierte die Autorin mit ihrem Roman “Caspar”, 2010 folgte “Fischvogel” und in diesem Bücherherbst erschien ihr dritter Roman “Atmen, bis die Flut kommt”. Für ihr literarisches Werk wurde die Autorin bereits mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet.
Die 1962 in Ellwangen geborene Beate Rothmaier studierte deutsche und französische Literatur und lebt heutzutage als freie Autorin in Zürich. Im Jahr 2005 debütierte die Autorin mit ihrem Roman “Caspar”, 2010 folgte “Fischvogel” und in diesem Bücherherbst erschien ihr dritter Roman “Atmen, bis die Flut kommt”. Für ihr literarisches Werk wurde die Autorin bereits mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Alina Bronsky, die 1978 in Russland geboren wurde und auf der asiatischen Seite des Ural-Gebirges aufwuchs, kam als Jugendliche nach Deutschland. Das nach ihrem Abitur begonnene Medizinstudium hat sie abgebrochen, stattdessen arbeitete sie als Werbetexterin und Redakteurin. Ihren größten Erfolg feierte die Autorin mit ihrem Debütroman “Scherbenpark”, der beim Publikum und bei den Kritikern ein großer Erfolg gewesen ist. Mittlerweile ist das Buch eine beliebte Schullektüre und wurde sogar verfilmt. In diesem Herbst erschien ihr neuester Roman “Nenn mich einfach Superheld”.
Alina Bronsky, die 1978 in Russland geboren wurde und auf der asiatischen Seite des Ural-Gebirges aufwuchs, kam als Jugendliche nach Deutschland. Das nach ihrem Abitur begonnene Medizinstudium hat sie abgebrochen, stattdessen arbeitete sie als Werbetexterin und Redakteurin. Ihren größten Erfolg feierte die Autorin mit ihrem Debütroman “Scherbenpark”, der beim Publikum und bei den Kritikern ein großer Erfolg gewesen ist. Mittlerweile ist das Buch eine beliebte Schullektüre und wurde sogar verfilmt. In diesem Herbst erschien ihr neuester Roman “Nenn mich einfach Superheld”.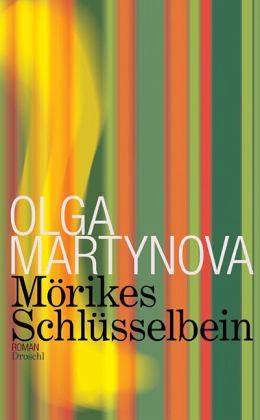
 Patrick Roth wurde 1953 geboren und lebt heutzutage als freier Schriftsteller in Los Angeles und Mannheim. Neben dem Schreiben ist Roth aber auch im Bereich Film tätig – 2006 erschien sein letztes filmisches Werk “In My Life – 12 Places I Remember”. Für seine bisherigen literarischen Veröffentlichungen wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet, zuletzt stand er mit seinem beeindruckenden Roman
Patrick Roth wurde 1953 geboren und lebt heutzutage als freier Schriftsteller in Los Angeles und Mannheim. Neben dem Schreiben ist Roth aber auch im Bereich Film tätig – 2006 erschien sein letztes filmisches Werk “In My Life – 12 Places I Remember”. Für seine bisherigen literarischen Veröffentlichungen wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet, zuletzt stand er mit seinem beeindruckenden Roman