 Mirko Bonné wurde 1965 in Tegernsee geboren und lebt heutzutage in Hamburg. In der Öffentlichkeit bekannt wurde er nicht nur durch seine schriftstellerischen Veröffentlichungen, sondern auch durch sein Werk als Übersetzer. Bisher hat er unter anderem Texte von Sherwood Anderson, E. E. Cummings und Emily Dickinson übertragen, der Autor und Übersetzer schreibt auch selbst Gedichte, Für seine Veröffentlichungen wurde Mirko Bonné bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit seinem aktuellen Roman “Nie mehr Nacht”, der bei Schöffling & Co. erschienen ist, steht er auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis.
Mirko Bonné wurde 1965 in Tegernsee geboren und lebt heutzutage in Hamburg. In der Öffentlichkeit bekannt wurde er nicht nur durch seine schriftstellerischen Veröffentlichungen, sondern auch durch sein Werk als Übersetzer. Bisher hat er unter anderem Texte von Sherwood Anderson, E. E. Cummings und Emily Dickinson übertragen, der Autor und Übersetzer schreibt auch selbst Gedichte, Für seine Veröffentlichungen wurde Mirko Bonné bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit seinem aktuellen Roman “Nie mehr Nacht”, der bei Schöffling & Co. erschienen ist, steht er auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis.
In “Nie mehr Nacht” erzählt Mirko Bonné die Geschichte von Markus Lee und seinem fünfzehnjährigen Neffen Jesse. Beide werden verbunden durch den Verlust eines geliebten Menschen: Ira. Sie hat sich das Leben genommen. In ihrem Auto, in der Garage vor ihrem Haus. Ira war die Schwester von Markus und die Mutter von Jesse. Was Onkel und Neffe nun zusammenhält sind die Erinnerungen an eine geliebte Bezugsperson und ein Verlust, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. In den Herbstferien reisen beide gemeinsam in die Normandie: Markus soll im Auftrag eines Kunstmagazins Brücken zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle gespielt haben. Jesse kommt mit, da die Familie seines besten Freundes in der Nähe ein verlassenes Strandhotel hütet. Die Reise ist geprägt von dem, was geschehen ist, Iras Selbstmord liegt einem Schatten gleich über Markus und Jesse, deren gemeinsame Zeit vor allem durch eine tiefgreifende Sprachlosigkeit geprägt ist. Wie soll man auch über einen so schweren Verlust sprechen? Wie kann man sich in seiner Trauer verständlich machen und mitteilen?
“Ich glaubte keinen Augenblick lang, je über Iras Tod hinwegkommen zu können, und wollte es auch gar nicht.”
Im verlassenen Strandhotel L’Angleterre, in dem auch ein Zimmer für Markus frei steht, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre – es ist vor allem Melancholie und Traurigkeit, entfacht von den leerstehenden Räumen und der verwunschenen Stimmung, die sich wie eine dicke Schicht um Markus legt. Ein Aufenthalt, der eigentlich eine Woche dauern soll, wird für Markus Lee zum Wendepunkt und zu einem Start in ein neues Leben. Aus den Herbstferien wird ein monatelanger Ausstieg aus dem alten Leben. Dieser Ausstieg und die gleichzeitige Abgrenzung von allem, was vorher war, ist vor allem auch eine Suche nach sich selbst und eine Suche nach Antworten. Antworten auf Fragen, die Markus Lee nach dem Tod seiner Schwester, nicht mehr loslassen: wie kann man das jahrelange Leben mit einem tiefgreifenden Geheimnis unbeschadet überstehen und wie kann man sich, wenn man alleine zurück bleibt, von diesem Geheimnis lösen, um weiterleben zu können?
Mirko Bonné umkreist in seinem Roman “Nie mehr Nacht” mehrere Themen: da ist zum einen Ira, die plötzlich aus dem Leben scheidet. Ira war immer anders. Während Markus gesellig ist und noch nie alleine gelebt hat, sucht Ira die Einsamkeit. Zehn Jahre lang reist die junge Frau durch die Welt, ohne eine Heimat finden zu können. Geprägt wurde ihr Alltag von Angst; ihr Haus bezeichnet sie als “Versteinerungszustand”. Ihre ewige Angst vor der dunklen Nacht hat Ira ausgelöscht, in dem sie in eben jene gegangen ist. Für immer. Geahnt, dass seine Schwester ihr eigenes Leben beenden könnte, hat Markus dennoch nicht. Wie schuldig kann man an dem Selbstmord eines anderen Menschen sein? Wie schuldig kann man daran sein, den Augenblick nicht erkannt zu haben?
“Wie den Augenblick, da das Blatt sich wendete, wie den Moment erkennen? War man denn in der Lage, einen Augenblick zu erkennen? Das hieße doch, sich auf den Zeitpunkt gefasst zu machen, da nichts mehr blieb, wie es eben noch war.”
Aber auch die Vergangenheit wird thematisiert: die Brücken in der Normandie stehen teilweise noch heute für das, was im Juni 1944 passiert ist, als die alliierten Streitkräfte in der Normandie gelandet sind. An den Brücken entzündeten sich die damaligen Begegnungen zwischen den Deutschen, den Kanadiern, den Briten und den Franzosen.
“Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es müssen Zigtausende gewesen sein, die ihr Leben gelassen haben, um eine dieser uralten Stahlkonstruktionen entweder halten, sprengen oder erstürmen zu können […].”
Markus Lee reist in die Normandie, um diese Brücken zu zeichnen, um etwas von ihrer Präsenz einzufangen, in dem Versuch abzubilden, was damals für ein Kampf an den Brücken getobt hat – heutzutage verbinden sie als ruhende Stahlkolosse zwei Ufer miteinander, damals ging es für die Soldaten um den Kampf um Leben und Tod. Doch als Markus die Brücken besichtigt, gelingt es ihm nicht, seine Eindrücke auch auf Papier zu bringen.
“Eine Zeichnung entstand, während ich das Gesehene in Bewegung übertrug. Was mich bewegte, ließ meine Hand den Stift übers Papier führen. Oder nichts entstand. Dann lag die Hand nur da, so regungslos auf dem Zeichenblock, wie ich im Innern fühllos blieb.”
Die Reise in die Normandie scheint für Markus, dem Erzähler des Romans, auch eine Art Reise zu sich selbst zu sein, denn plötzlich ist er mit sich konfrontiert und mit seinem Leben. Mit seiner Einsamkeit, mit seiner Trägheit und mangelnden Zielstrebigkeit, mit dem Verlust seiner geliebte Schwester. In der Normandie kehrt Ira zurück, in Gestalt eines Fotos, das Markus in einem Geschäft in der Innenstadt sieht und auf dem er glaubt, seine tote Schwester zu erkennen. Sein ganzes Denken kreist um die Frage, warum Ira ein Doppelleben in Frankreich hätte führen sollen – doch ist das wirklich Ira oder nur ein Hirngespinst und der Wunsch, nicht ohne sie weiterleben zu müssen. Es ist die falsche Ira, die Markus wieder zurückholt unter die Lebenden. Mirko Bonné zeichnet den Weg von Markus in aller Konsequenz zu Ende; er lässt ihn zum Aussteiger werden, der sich aus seinem alten Leben verabschiedet und mit dem Nötigsten und auf sich selbst zurückgeworfen in einem leerstehenden Hotel zurückbleibt.
“Jede Zeichnung erzählt eine komplizierte Geschichte, in dem sie extrem vereinfacht, dachte ich. Aber die Vereinfachung ist nur ein Durchgangsstadium. Sie muss viel weiter gehen, immer weiter. Nicht nur was und wie ich zeichne, auch ich selber muss immer einfacher werden. Zeichne auf immer weniger Blättern immer weniger Linien. Werde unscheinbarer, Strich für Strich. Ja genau: Zeichne dich ins Verschwinden hinein!”
Das Thema des Romans, das über allen anderen schwebt – unsichtbar und doch zum Greifen nah – wird immer wieder angedeutet, es gibt zahlreiche Hinweise und Anspielungen. Am Ende wird es noch einmal deutlich ausgesprochen. Diese Enthüllung gleicht einem fulminanten Paukenschlag, einem Paukenschlag, der für mein Empfinden nicht nötig gewesen wäre, da er den Roman auf die Enthüllung reduziert und ihm damit ein Stück weit seiner Ernsthaftigkeit beraubt.
Mirko Bonné hat mit “Nie mehr Nacht” einen wunderbar poetischen und tief melancholischen Roman geschrieben, der eine Vielzahl an Themenkomplexe umkreist, die mich auch nach dem Ende des Romans lange nicht loslassen wollten. “Nie mehr Nacht” ist ein Roman über Einsamkeit, Trauer und Schuldgefühle und über den Wunsch, noch einmal neu anfangen zu dürfen.

 Olaf Kühl wurde 1955 geboren und ist nach einem Studium der Slawistik, Osteuropäischer Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin heutzutage überwiegend als Übersetzer tätig. Für sein polnisch-deutsches Übersetzerwerk wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis ausgezeichnet. Seit 1996 ist er außerdem als Russlandreferent des Berliner Bürgermeisters tätig. Vor zwei Jahren erschien sein Debütroman “Tote Tiere”. Mit seiner aktuellen Veröffentlichung “Der wahre Sohn” wurde Olaf Kühl für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Olaf Kühl wurde 1955 geboren und ist nach einem Studium der Slawistik, Osteuropäischer Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin heutzutage überwiegend als Übersetzer tätig. Für sein polnisch-deutsches Übersetzerwerk wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis ausgezeichnet. Seit 1996 ist er außerdem als Russlandreferent des Berliner Bürgermeisters tätig. Vor zwei Jahren erschien sein Debütroman “Tote Tiere”. Mit seiner aktuellen Veröffentlichung “Der wahre Sohn” wurde Olaf Kühl für den Deutschen Buchpreis nominiert.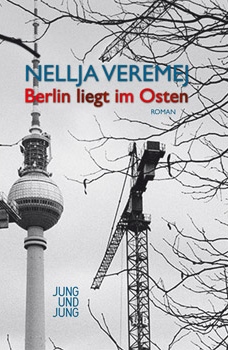
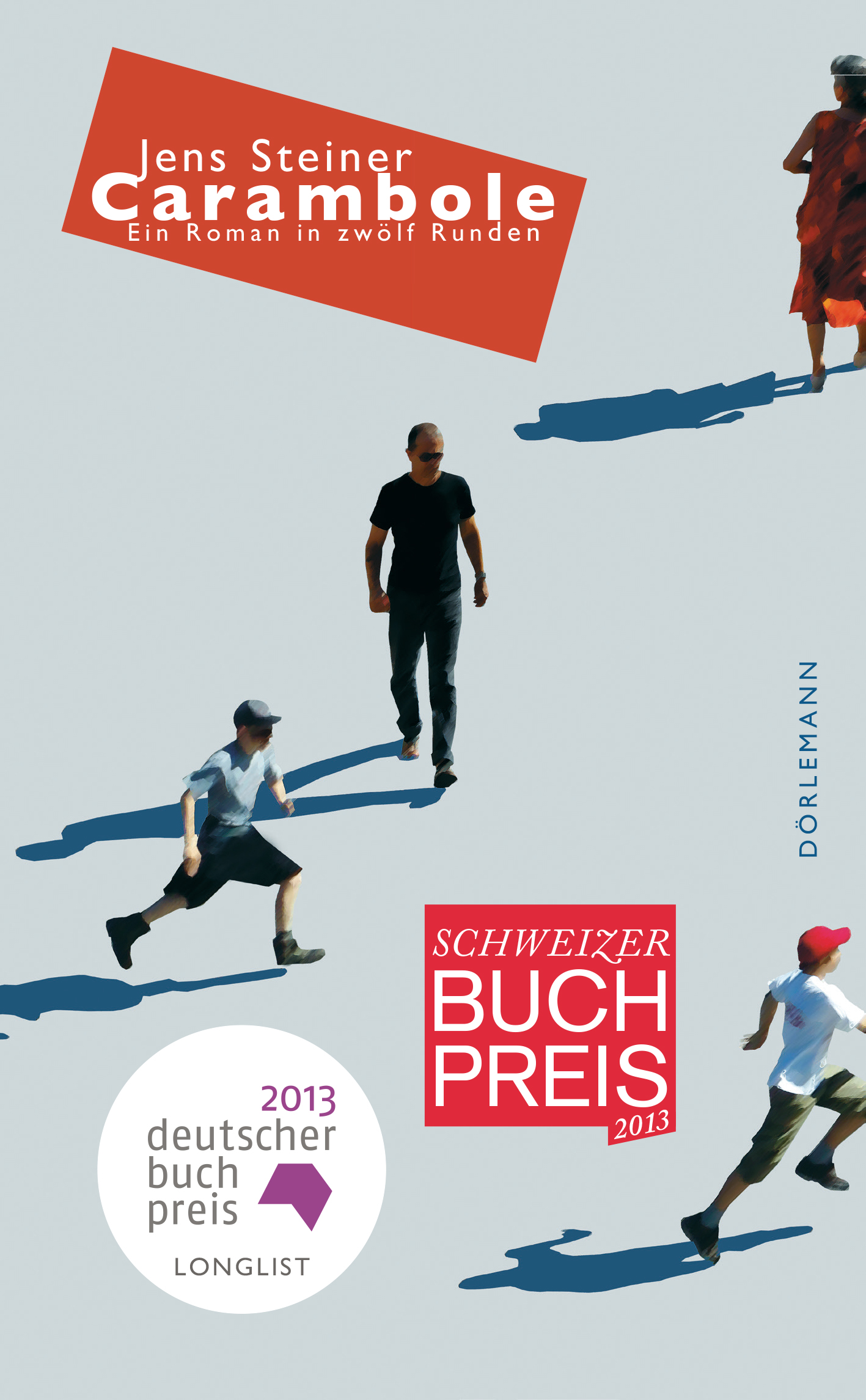 Jens Steiner wurde 1975 geboren, hat Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf studiert und arbeitete nach dem Studium als Lehrer und Lektor. Er fand sich bereits 2011 mit seinem Romandebüt “Hasenleben” auf der Longlist des Deutschen Buchpreis wieder und ist in diesem Jahr erneut mit seinem Roman “Carambole” vertreten. Für das Romanmanuskript wurde er bereits im vergangenen Jahr mit dem Preis “Das zweite Buch” der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. Der Autor betreibt eine aufwendige und schön gestaltete
Jens Steiner wurde 1975 geboren, hat Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf studiert und arbeitete nach dem Studium als Lehrer und Lektor. Er fand sich bereits 2011 mit seinem Romandebüt “Hasenleben” auf der Longlist des Deutschen Buchpreis wieder und ist in diesem Jahr erneut mit seinem Roman “Carambole” vertreten. Für das Romanmanuskript wurde er bereits im vergangenen Jahr mit dem Preis “Das zweite Buch” der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. Der Autor betreibt eine aufwendige und schön gestaltete  Michael Roes wurde 1960 in Rhede in Westfalen geboren. Mehrjährige Aufenthalte im Jemen, in Israel und in Amerika sind ein wichtiger Fundus, aus dem er Inspiration für seine Bücher schöpft. Für sein vielfältiges Werk wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet, zuletzt stand er im vergangenen Jahr mit dem vorliegenden Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreis.
Michael Roes wurde 1960 in Rhede in Westfalen geboren. Mehrjährige Aufenthalte im Jemen, in Israel und in Amerika sind ein wichtiger Fundus, aus dem er Inspiration für seine Bücher schöpft. Für sein vielfältiges Werk wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet, zuletzt stand er im vergangenen Jahr mit dem vorliegenden Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreis. Horst Bienek, der 1930 geboren wurde und 1990 starb, war Schriftsteller, Künstler und Filmemacher. Nach einer Tätigkeit beim Hessischen Rundfunk und als Lektor bei dtv, lebte er ab 1968 als freier Schriftsteller in München. Für seine Veröffentlichungen erhielt er unter anderem den Wilhelm-Raabe-Preis sowie den Jean-Paul-Preis. Herausgegeben und mit einem lesenswerten Nachwort ergänzt, wurde “Workuta” von Michael Krüger, der viele Jahre lang Horst Bieneks Lektor und Verleger gewesen ist. Die Aufzeichnungen, die diesem Buch zugrunde liegen, hat Michael Krüger nach dem Tod seines Freundes in dessen Unterlagen gefunden und macht sie mit dieser Veröffentlichung zum ersten Mal einem breiteren Publikum zugänglich.
Horst Bienek, der 1930 geboren wurde und 1990 starb, war Schriftsteller, Künstler und Filmemacher. Nach einer Tätigkeit beim Hessischen Rundfunk und als Lektor bei dtv, lebte er ab 1968 als freier Schriftsteller in München. Für seine Veröffentlichungen erhielt er unter anderem den Wilhelm-Raabe-Preis sowie den Jean-Paul-Preis. Herausgegeben und mit einem lesenswerten Nachwort ergänzt, wurde “Workuta” von Michael Krüger, der viele Jahre lang Horst Bieneks Lektor und Verleger gewesen ist. Die Aufzeichnungen, die diesem Buch zugrunde liegen, hat Michael Krüger nach dem Tod seines Freundes in dessen Unterlagen gefunden und macht sie mit dieser Veröffentlichung zum ersten Mal einem breiteren Publikum zugänglich. Die Schriftstellerin Astrid Rosenfeld wurde 1977 in Köln geboren und hat in diversen Jobs in der Filmbranche gearbeitet, unter anderem war sie als Casterin tätig. Heutzutage lebt sie in Berlin.
Die Schriftstellerin Astrid Rosenfeld wurde 1977 in Köln geboren und hat in diversen Jobs in der Filmbranche gearbeitet, unter anderem war sie als Casterin tätig. Heutzutage lebt sie in Berlin.