 Der 1967 geborene Autor Navid Kermani lebt als freier Schriftsteller in Köln. Kermani hat Orientalistik, Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und sich im Bereich Islamwissenschaft promoviert und habilitiert. Für seine bisherigen Veröffentlichungen wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet. Im Jahr 2011 erhielt er den Hannah-Arendt-Preis. Sein Roman “Dein Name”, der im Hanser Literaturverlag erschien, war 2011 für den Buchpreis nominiert. Doch der Autor ist nicht nur für seine Romane bekannt, sondern auch für seine Reportagen und wissenschaftlichen Werke, mit denen er auch immer wieder politisch Stellung bezieht.
Der 1967 geborene Autor Navid Kermani lebt als freier Schriftsteller in Köln. Kermani hat Orientalistik, Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und sich im Bereich Islamwissenschaft promoviert und habilitiert. Für seine bisherigen Veröffentlichungen wurde der Autor bereits vielfach ausgezeichnet. Im Jahr 2011 erhielt er den Hannah-Arendt-Preis. Sein Roman “Dein Name”, der im Hanser Literaturverlag erschien, war 2011 für den Buchpreis nominiert. Doch der Autor ist nicht nur für seine Romane bekannt, sondern auch für seine Reportagen und wissenschaftlichen Werke, mit denen er auch immer wieder politisch Stellung bezieht.
Das Buch “Ausnahmezustand”, das den Untertitel Reisen in eine beunruhigte Welt trägt, versammelt Reportagen von Navid Kermani, die in gekürzter Fassung in den letzten Monaten bereits in einigen Zeitungen erschienen sind. Navid Kermani nimmt den Leser mit auf eine Reise, eine Reise durch neun Länder, die ganz unterschiedlich sind, doch eines gemeinsam haben: in ihnen herrscht ein Ausnahmezustand, der die Menschen zur Verzweiflung bringt. Es sind Länder, in die kein Übertragungswagen von CNN fährt, doch Navid Kermani hat sich aufgemacht, um genau diese Schauplätze zu besuchen und in zehn lesenswerten und mitreißenden Reportagen vorzustellen.
Die Reise führt den Leser über Kaschmir und Dehli nach Gujarat, über Pakistan nach Afghanistan, von Teheran nach Syrien, von Palästina nach Lampedusa. Navid Kermani reist als westlicher Beobachter in Länder, in die es nur selten Besucher verschlägt. Die Reportagen von Kermani sind keine nüchternen Kriegsberichterstattungen – dem Autor gelingt es stattdessen, einen ganz persönlichen Blick auf die Länder zu werfen, die er besucht. Seine Beobachtungen erwecken den Eindruck, als würde er die Gebiete, die er bereist, ganz unvoreingenommen bereisen. Offen, fragend und interessiert begegnet er der zivilen Bevölkerung, aber auch den politisch Beteiligten. Kermani beobachtet nicht nur, sondern befragt die betroffene Bevölkerung – es sind vor allem die Zitate der Menschen, die im Ausnahmezustand leben, die das Buch und die Reportagen so beeindruckend und lesenswert machen.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir Kermanis Reise nach Kaschmir. Kaschmir ist “eine Stadt im Krieg”. Während der Begriff Ausnahmezustand eigentlich einen vorübergehenden und plötzlichen Zustand suggeriert, hat sich Kaschmir bereits seit zwanzig Jahren in diesem Zustand eingerichtet.
“Die Teilung des indischen Subkontinents hat viele Wunden gerissen, eine Million Menschen, die starben, sieben Millionen, die ihre Heimat aufgeben mußten.”
Aber auch die Reisen nach Afghanistan, über die es zwei Reportagen gibt, sind lesenswert, wenn auch zugleich erschreckend. Darauf deutet bereits der Titel der zweiten Reportage über Afghanistan hin: “Grenzen des Berichtbaren”. Es gibt Grenzen des Berichtbaren, in Afghanistan wird das, worüber berichtet werden kann, zusätzlich durch die Tatsache eingeschränkt, dass weite Teile des Landes so zerklüftet sind, dass sie kaum noch zugänglich sind. Doch Navid Kermani berichtet, er berichtet eindringlich und schmerzhaft von dem, was er sieht und erlebt. Er berichtet über Nur Agha, der auf einem Friedhof lebt. Er hat seine ganze Familie verloren.
“Als der Krieg vor zwanzig Jahren in die Straßen Kabuls schwappte, Kampf um jedes Haus und von den Bergen Raketen, fuhr er nach Jalalabad voraus, um der Familie eine Zuflucht zu besorgen. Nach Kabul zurückgekehrt, um die Familie abzuholen, hatte eine Bombe sein Haus zerstört, die Frau, alle fünf Kinder und eine Schwester tot.”
Kermani reist im September 2012 nach Syrien, besucht Orte, an denen keine fünfhundert Meter entfernt, der Krieg tobt und doch eine beinahe schon erschreckende Normalität herrscht. Auf diese Normalität trifft der Autor auch in Lampedusa, einem italienischen Ort an der Küste, in dem Flüchtlinge ankommen – zum Zeitpunkt der Reportage waren es bereits beinahe 20.000. 20.000 Flüchtlinge in nicht einmal einem Jahr – 20.000 Menschen, die ihr bisheriges Leben aufgeben, um in eine Zukunft zu reisen, von der sie nicht einmal erahnen können, wie diese aussehen wird. Trotz der existenziellen Situationen dieser Flüchtlinge, die Tag für Tag in Lampedusa eintreffen, hat die Stadt den Flair eines Urlaubsortes nicht verloren.
“Auf der ganzen Welt haben die Reichen ihre Methoden verfeinert, mit denen sie die Wirklichkeit aussperren, haben Zäune gebaut, Mauern, Feindbilder, um das Elend nur ja nicht zu sehen, aber daß es ihnen sogar auf Lampedusa gelingt, bei 19 820 Flüchtlingen allein in diesem Jahr und einer Bevölkerung von fünftausend, stellt jede gated community in den Schatten.”
Beinahe genau so schlimm, wie die Zustände, die Navid Kermani beschreibt, ist die Tatsache, dass all dies in Regionen und Gebieten stattfindet, die von dem Rest der Welt vergessen scheinen. Die Welt kümmert sich nicht mehr um Kaschmir – berichtet wird erst, wenn es zu Anschlägen mit mehr als acht Toten kommt, vorher ist eine Meldung für die Medien weder interessant, noch relevant.
“[…] daß die Welt sich überhaupt nicht um Kaschmir kümmert, sich allenfalls noch dunkel an die Enthauptung eines westlichen Touristen erinnert.”
“Ausnahmezustand” ist ein mutiges Buch, eines mutigen Autors, dem es durch seine eindringlichen Worte hoffentlich gelingen wird, Leser und Leserinnen auf Orte unserer Welt aufmerksam zu machen, die drohen, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden. “Ausnahmezustand” ist ein politisches Buch, ein wichtiges Buch und gleichsam ein sehr persönliches Buch, dessen Lektüre ich nur empfehlen kann. Eine sehr lesenswerte Besprechung findet ihr auch bei Kai.


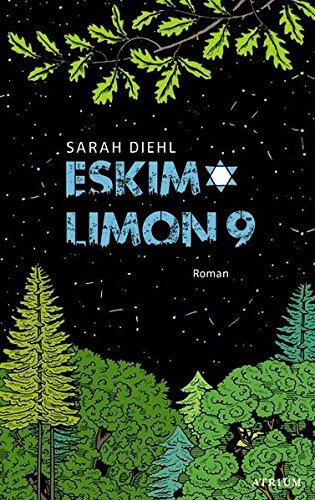 Bei
Bei  Katharina Hartwell wurde 1984 in Köln geboren. Nach ihrem Abitur folgte ein Studium der Anglistik und Amerikanistik, das sie mit Auszeichnung abschloss. Im Anschluss ging sie an das Deutsche Literaturinstitut nach Leipzig, wo sie seit 2010 studiert. Bisher erschien von der jungen Autorin, die bereits mit Preis und Stipendium dekoriert ist, der Erzählungsband “Im Eisluftballon”. “Das fremde Meer”, dass in diesem Büchersommer im Berlin Verlag erschienen ist, ist ihr erster Roman.
Katharina Hartwell wurde 1984 in Köln geboren. Nach ihrem Abitur folgte ein Studium der Anglistik und Amerikanistik, das sie mit Auszeichnung abschloss. Im Anschluss ging sie an das Deutsche Literaturinstitut nach Leipzig, wo sie seit 2010 studiert. Bisher erschien von der jungen Autorin, die bereits mit Preis und Stipendium dekoriert ist, der Erzählungsband “Im Eisluftballon”. “Das fremde Meer”, dass in diesem Büchersommer im Berlin Verlag erschienen ist, ist ihr erster Roman. Jochen Schmidt wurde 1970 in Berlin geboren und arbeitet heutzutage als Autor und Journalist. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die taz und veröffentlichte zuletzt “Schmidt liest Proust” und “Dudenbrooks”. “Schneckenmühle” ist seine neueste Veröffentlichung und erschien in diesem Frühjahr im C.H.Beck Verlag.
Jochen Schmidt wurde 1970 in Berlin geboren und arbeitet heutzutage als Autor und Journalist. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die taz und veröffentlichte zuletzt “Schmidt liest Proust” und “Dudenbrooks”. “Schneckenmühle” ist seine neueste Veröffentlichung und erschien in diesem Frühjahr im C.H.Beck Verlag.
 Zdenka Becker wurde 1951 in Eger geboren. Die Autorin ist in Bratislava aufgewachsen, wohnt aber seit den siebziger Jahren in Österreich. Sie schreibt in deutscher Sprache und hat bereits einige Bücher veröffentlicht, für die sie mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet wurde. “Der größte Fall meines Vaters” ist ihre neueste Veröffentlichung und im Frühjahr im Deuticke Verlag erschienen.
Zdenka Becker wurde 1951 in Eger geboren. Die Autorin ist in Bratislava aufgewachsen, wohnt aber seit den siebziger Jahren in Österreich. Sie schreibt in deutscher Sprache und hat bereits einige Bücher veröffentlicht, für die sie mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet wurde. “Der größte Fall meines Vaters” ist ihre neueste Veröffentlichung und im Frühjahr im Deuticke Verlag erschienen. Hannes Stein wurde 1965 in München geboren und arbeitet heutzutage als Autor und Journalist. Er ist in Österreich aufgewachsen, lebt jedoch seit einigen Jahren in Amerika. Als Journalist ist er für unterschiedliche Medien tätig, unter anderem für die Literarische Welt. Sein Roman “Der Komet” wurde in diesem Frühjahr im Galiani Berlin Verlag veröffentlicht.
Hannes Stein wurde 1965 in München geboren und arbeitet heutzutage als Autor und Journalist. Er ist in Österreich aufgewachsen, lebt jedoch seit einigen Jahren in Amerika. Als Journalist ist er für unterschiedliche Medien tätig, unter anderem für die Literarische Welt. Sein Roman “Der Komet” wurde in diesem Frühjahr im Galiani Berlin Verlag veröffentlicht.