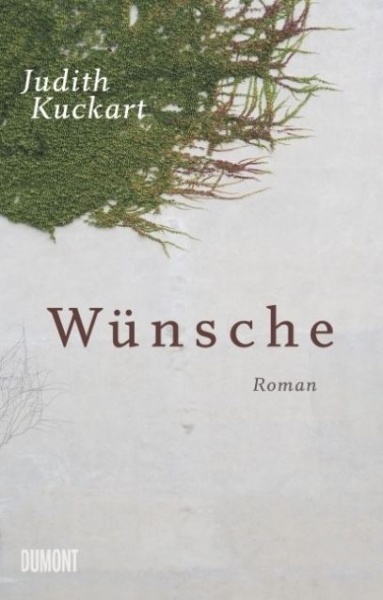 Judith Kuckart wurde 1959 in Schwelm geboren und lebt heutzutage in Berlin und Zürich. Sie ist als Autorin und Regisseurin tätig. Von Judith Kuckart, die mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, erschien zuletzt der Roman “Die Verdächtige”. Der Roman “Wünsche”, der in diesem Frühjahr im Dumont Verlag erschien, ist ihre neueste Veröffentlichung.
Judith Kuckart wurde 1959 in Schwelm geboren und lebt heutzutage in Berlin und Zürich. Sie ist als Autorin und Regisseurin tätig. Von Judith Kuckart, die mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, erschien zuletzt der Roman “Die Verdächtige”. Der Roman “Wünsche”, der in diesem Frühjahr im Dumont Verlag erschien, ist ihre neueste Veröffentlichung.
Judith Kuckart erzählt in ihrem Roman “Wünsche” die Geschichte von Vera. Vera arbeitet als Lehrerin und unterrichtet an der Berufsschule die Maler- und Lackiererklasse, manchmal auch die Installateure, Maurer und Schreiner. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann Karatsch und dem gemeinsamen Sohn Jo. Karatsch heißt eigentlich Kreitel, Franz-Josef Kreitel, aber alle nennen ihn Karatsch. Jo ist neunzehn und studiert ab dem kommenden Semester Schiffbautechnik in Kiel. Vera und Karatsch führen auf den ersten Blick eine normale Ehe, erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass Vera zwanzig Jahre jünger ist. Karatsch war ihr Pflegevater, bevor er nach dem Tod seiner Frau Suse zu ihrem Ehemann geworden ist. Eine seltsame Verbindung, ein seltsames Verhältnis; etwas, was jedoch nie thematisiert wird.
“Ja, die Zeit vergeht, der Film bleibt, und Karatsch ist wirklich ein Schwein. Den alten Film schaut er so inbrünstig an, weil er noch immer die Tochter Vera liebt, nicht seine Frau Vera. Wenn er mit ihr schläft, betrügt er Vera mit der Vera von früher, mit jenem mageren, hübschen, räudigen kleine Ding, das sie einmal war.”
Der spürbar feine und geschliffene Ton von Judith Kuckart Erzählstrom setzt am Silvestermorgen ein. An Silvester hat Vera Geburtstag – in diesem Jahr wird sie 46 Jahre alt. An Silvester laden Vera und Karatsch Freunde ein, immer dieselben Menschen, immer derselbe Ablauf, immer der gleiche Film, den sie sich gemeinsam anschauen. Doch an diesem Silvestermorgen soll alles anders werden; Vera geht schwimmen und kehrt nicht mehr nach Hause zurück.
“Wie man es schaffen kann, dass man gern lebt, bis zum Schluss.”
Vera hat Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche – sie möchte nicht immer den gleichen Trott erleben, sie wünscht sich Abwechslung. “So uralt wie das Bild, das Karatsch von ihr hat, kann sie eh nicht mehr werden.” Im Schwimmbad lässt sich Vera den Schrank einer anderen Besucherin aufschließen. Sie schlüpft nicht nur in fremde Kleidung, sondern auch in ein fremdes Leben; zieht dieses über, wie eine zweite Haut. Mit ihrem neuen Namen, Salomé Schreiner, reist Vera nach London. Kann sie in London endlich heraus finden, wer sie eigentlich ist und was sie vom Leben möchte? Kann sie in London endlich wieder anfangen zu leben und aufhören, sich selbst beim Älterwerden zuzuschauen?
“Und ebenfalls ab heute gilt: Es werden keine alten Filme mehr angeschaut, sondern ein neuer wird gedreht. Regie, Kamera, Hauptdarstellerin: ICH. Location: London. Verwendbares Material: das Gefühl des Augenblicks.”
Zeitgleich zu Veras Flucht nach London erfüllt sich Friedrich Wünsche einen Wunschtraum: er wagt mit fünfundvierzig Jahren einen Neuanfang und eröffnet das Warenhaus Wünsche. Seine Geschäftsidee ist es, mit Haus Wünsche zu dem Konzept der alten Tante-Emma-Läden zurückzukehren, doch gleichzeitig modernstes Management zu betreiben. Friedrich Wünsche wagt ein Risiko, denn ein Erfolg ist nicht garantiert.
Judith Kuckart legt mit “Wünsche” einen klug komponierten Roman vor. Insgesamt konzentriert sich die Autorin auf die Lebensverläufe von sechs Figuren, die im ersten und dritten Abschnitt gemeinsam betrachtet werden und denen im Mittelteil – einer Nahaufnahme ähnlich – jeweils ein eigenes Kapitel geschenkt wird. Die Lebensverläufe der Figuren sind eng verknüpft und stellenweise schon fast auf magische Art und Weise verbunden. Es kommt so Begegnungen und Wiederbegegnungen; die Wege kreuzen sich.
Der Roman widmet sich auf knapp 300 Seiten mehreren Themen. Das Hauptthema klingt bereits im Titel an: es geht um Wünsche, um die Erfüllung von Wünschen und darum, wie sich ein wunschloses Leben anfühlt, in dem die Wünsche unter der Last des Alltags abgestorben sind. Gleichzeitig geht es um das Alter, das Älterwerden und darum, wie man damit umgehen kann. Karatsch resigniert an seinem Alter, das ihn zunehmend einschränkt. Vera möchte nicht alt werden, möchte die Jahre, die ihr verloren gegangen sind wieder einfangen und neu leben können. Doch die Erfüllung von Wünschen bedeutet häufig auch, dass man Mut haben muss, dass man etwas wagen muss, dass man sich trauen muss, etwas zu tun, auch wenn es das Risiko gibt, alles dabei zu verlieren. Das Verfolgen der eigenen Vorstellungen gleicht einem Verzicht auf Sicherheit und Geborgenheit – ist man bereit, dies aufzugeben?
“Denn Geborgenheit war auch Glück. Im Glück oder in der Geborgenheit eines kleines Lebens […].”
Auch das Leben in der Provinz wird in Judith Kuckarts Roman thematisiert. Vera lebt in einer Stadt, die so klein ist, “dass man sich immer zweimal am Tag traf.” Ein Leben in der Provinz führt dazu, dass man sich nicht verstecken kann, man wird gesehen und nichts bleibt unbeobachtet. Jeder kennt jeden und alles bleibt gleich, in der Provinz kann man nur derjenige sein, der man immer gewesen ist und den alle kennen. Wer versucht, aus diesen Strukturen auszubrechen, bleibt häufig alleine zurück.
“In der Provinz zu leben ist wie Warten. Provinz liegt außerhalb der Zeit, nichts ändert sich, alles bleibt gleich und noch dazu im Schatten.”
Der Erzählton des Romans ist fein und geschliffen. Viele der Sätze von Judith Kuckart sind kleine Miniaturkunstwerke, denen jedoch stellenweise die Verbindung miteinander fehlt. Trotz aller Kunstfertigkeit ist die Sprache nicht unbedingt poetisch, sondern unterkühlt und nüchtern. Die Figurenzeichnung bleibt dabei manchmal auf der Strecke, denn trotz des intensiven Blicks, den Judith Kuckart auf ihre Figuren richtet, bleiben mir diese doch seltsam fremd und konturenlos.
Dennoch habe ich den Roman als lesenswert empfunden, denn die sprachlichen Bilder sind ein Lesegenuss und auch die Motive, die Judith Kuckart in ihrem Roman thematisiert, sind eindrucksvoll und es wert, darüber nachzudenken. Judith Kuckart erinnert in diesem Roman weniger an eine Autorin, als an eine Regisseurin, die Szenen erschafft, die kleinen Kunstwerken gleichen, denen jedoch ein verbindendes Element fehlt. “Wünsche” ist ein Roman, der mich zwiespältig zurückgelassen hat. Es ist ein sperriger Roman, aber es lohnt sich, sich mit diesem Text zu beschäftigen.


 Björn Bicker wurde 1972 geboren und hat Literaturwissenschaft, Philosophie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen und Wien studiert. Nach Stationen am Wiener Burgtheater und den Münchener Kammerspielen, arbeitet Björn Bicker seit 2009 als freier Autor, Projektentwickler und Kurator. Im selben Jahr erschien im Verlag Antje Kunstmann sein Debütroman “Illegal”. Der Autor lebt heutzutage in München und hat in diesem Frühjahr mit “Was wir erben” seinen zweiten Roman vorgelegt. Der Autor betreibt eine eigene
Björn Bicker wurde 1972 geboren und hat Literaturwissenschaft, Philosophie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen und Wien studiert. Nach Stationen am Wiener Burgtheater und den Münchener Kammerspielen, arbeitet Björn Bicker seit 2009 als freier Autor, Projektentwickler und Kurator. Im selben Jahr erschien im Verlag Antje Kunstmann sein Debütroman “Illegal”. Der Autor lebt heutzutage in München und hat in diesem Frühjahr mit “Was wir erben” seinen zweiten Roman vorgelegt. Der Autor betreibt eine eigene  Monika Held, die 1943 in Hamburg geboren wurde, arbeitet als Autorin und Journalisten. Einer ihrer Themenschwerpunkte ist das Kriegsrecht in Polen und die Hilfstransporte zu den Überlebenden von Auschwitz. Für diese publizistische Arbeit wurde sie mit einer Dankbarkeitsmedaille ausgezeichnet. Heutzutage lebt die Autorin in Frankfurt. Im Eichborn Verlag sind von ihr bereits die Romane “Augenbilder” und “Melodie für einen schönen Mann” erschienen.
Monika Held, die 1943 in Hamburg geboren wurde, arbeitet als Autorin und Journalisten. Einer ihrer Themenschwerpunkte ist das Kriegsrecht in Polen und die Hilfstransporte zu den Überlebenden von Auschwitz. Für diese publizistische Arbeit wurde sie mit einer Dankbarkeitsmedaille ausgezeichnet. Heutzutage lebt die Autorin in Frankfurt. Im Eichborn Verlag sind von ihr bereits die Romane “Augenbilder” und “Melodie für einen schönen Mann” erschienen.
 Hans Sahl wurde 1902 in Dresden geboren. Bereits in den 1920er Jahren begann er damit Filmkritiken und erste Erzählungen zu schreiben. 1933 war er zur Flucht aus Deutschland gezwungen, zunächst reiste er nach Frankreich, später in die USA. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg war er als Kulturkorrespondent für mehrere Zeitungen tätig. 1993 starb Hans Sahl. “Der Mann, der sich selbst besuchte” versammelt die Erzählungen und Glossen des Autors und ist der vierte Band einer vom Luchterhand Verlag herausgegebenen Werkausgabe. Zuvor erschienen bereits:
Hans Sahl wurde 1902 in Dresden geboren. Bereits in den 1920er Jahren begann er damit Filmkritiken und erste Erzählungen zu schreiben. 1933 war er zur Flucht aus Deutschland gezwungen, zunächst reiste er nach Frankreich, später in die USA. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg war er als Kulturkorrespondent für mehrere Zeitungen tätig. 1993 starb Hans Sahl. “Der Mann, der sich selbst besuchte” versammelt die Erzählungen und Glossen des Autors und ist der vierte Band einer vom Luchterhand Verlag herausgegebenen Werkausgabe. Zuvor erschienen bereits:  Birk Meinhardt wurde 1959 in Berlin geboren und arbeitete als Sportjournalist und Reporter. Er wurde bereits zwei mal mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet und lebt als freier Schriftsteller in Berlin. 2007 erschien sein letzter Roman, “Im Schatten der Diva”. “Brüder und Schwestern” ist sein neuester Roman; veröffentlicht im Hanser Literaturverlag.
Birk Meinhardt wurde 1959 in Berlin geboren und arbeitete als Sportjournalist und Reporter. Er wurde bereits zwei mal mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet und lebt als freier Schriftsteller in Berlin. 2007 erschien sein letzter Roman, “Im Schatten der Diva”. “Brüder und Schwestern” ist sein neuester Roman; veröffentlicht im Hanser Literaturverlag. Der 1971 geborene Florian Werner ist promovierter Literaturwissenschaftler und lebt als Autor, Journalist und Übersetzer in Berlin. Zuletzt erschien von ihm “Dunkle Materie: Die Geschichte der Scheiße”. Seine aktuelle Veröffentlichung “Schüchtern” erschien im vergangenen Jahr bei Nagel & Kimche.
Der 1971 geborene Florian Werner ist promovierter Literaturwissenschaftler und lebt als Autor, Journalist und Übersetzer in Berlin. Zuletzt erschien von ihm “Dunkle Materie: Die Geschichte der Scheiße”. Seine aktuelle Veröffentlichung “Schüchtern” erschien im vergangenen Jahr bei Nagel & Kimche.