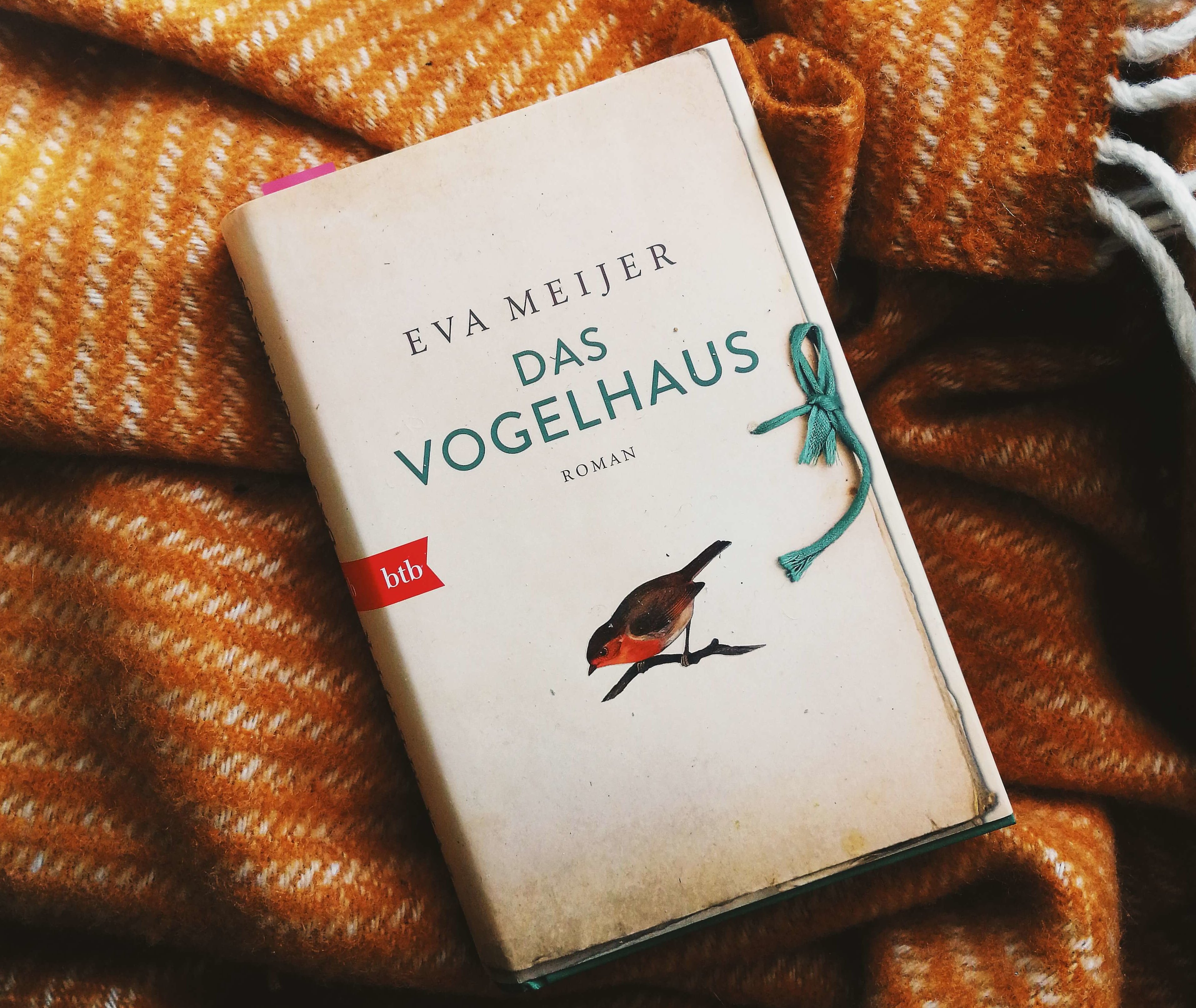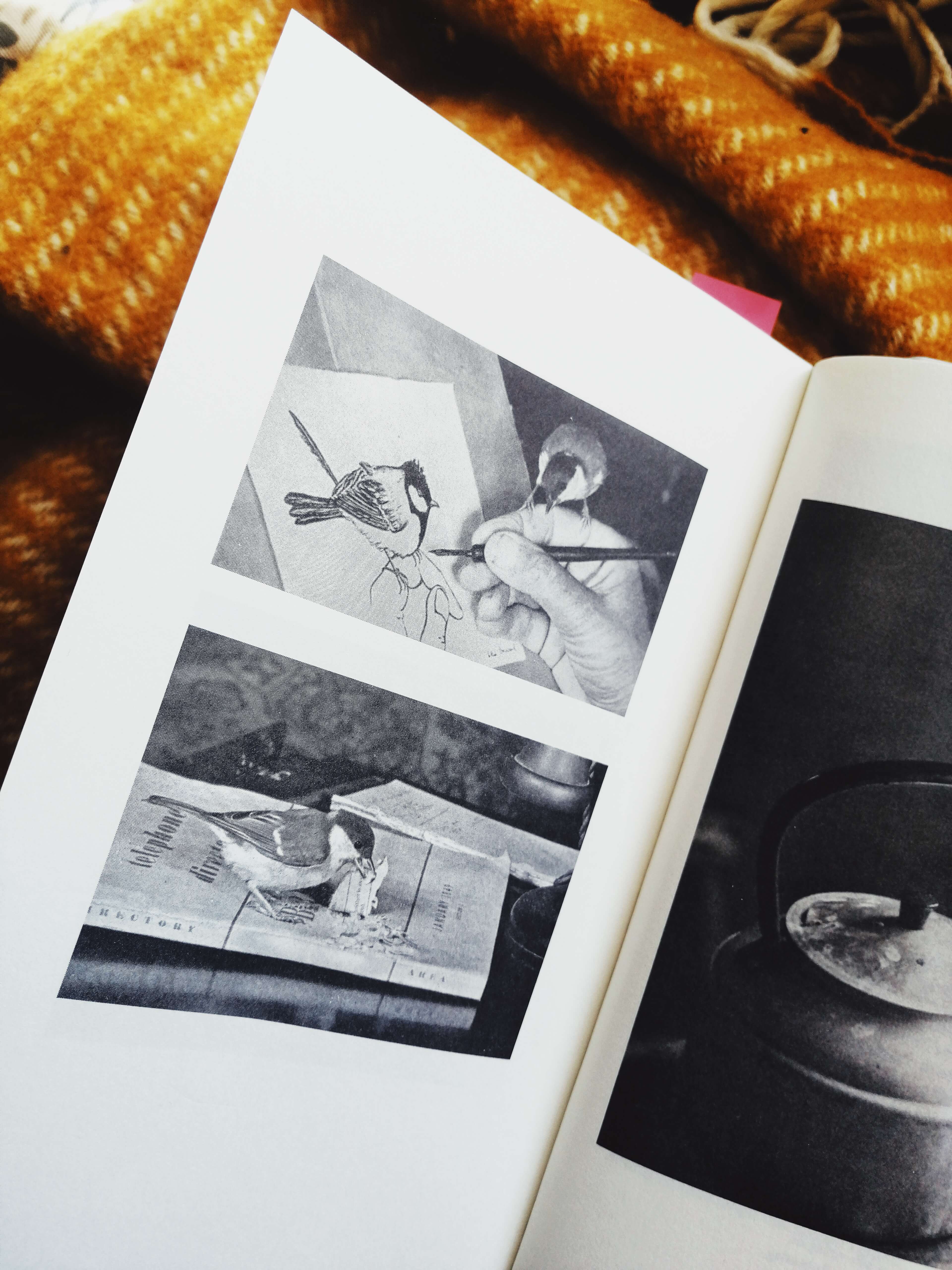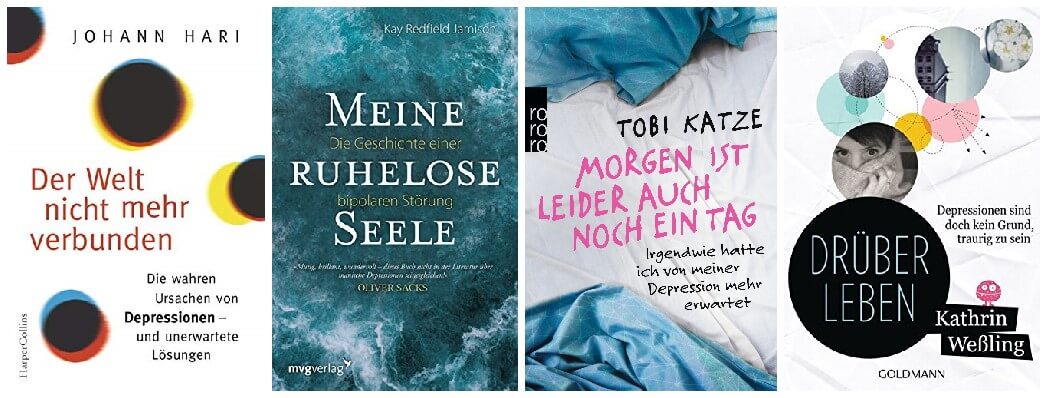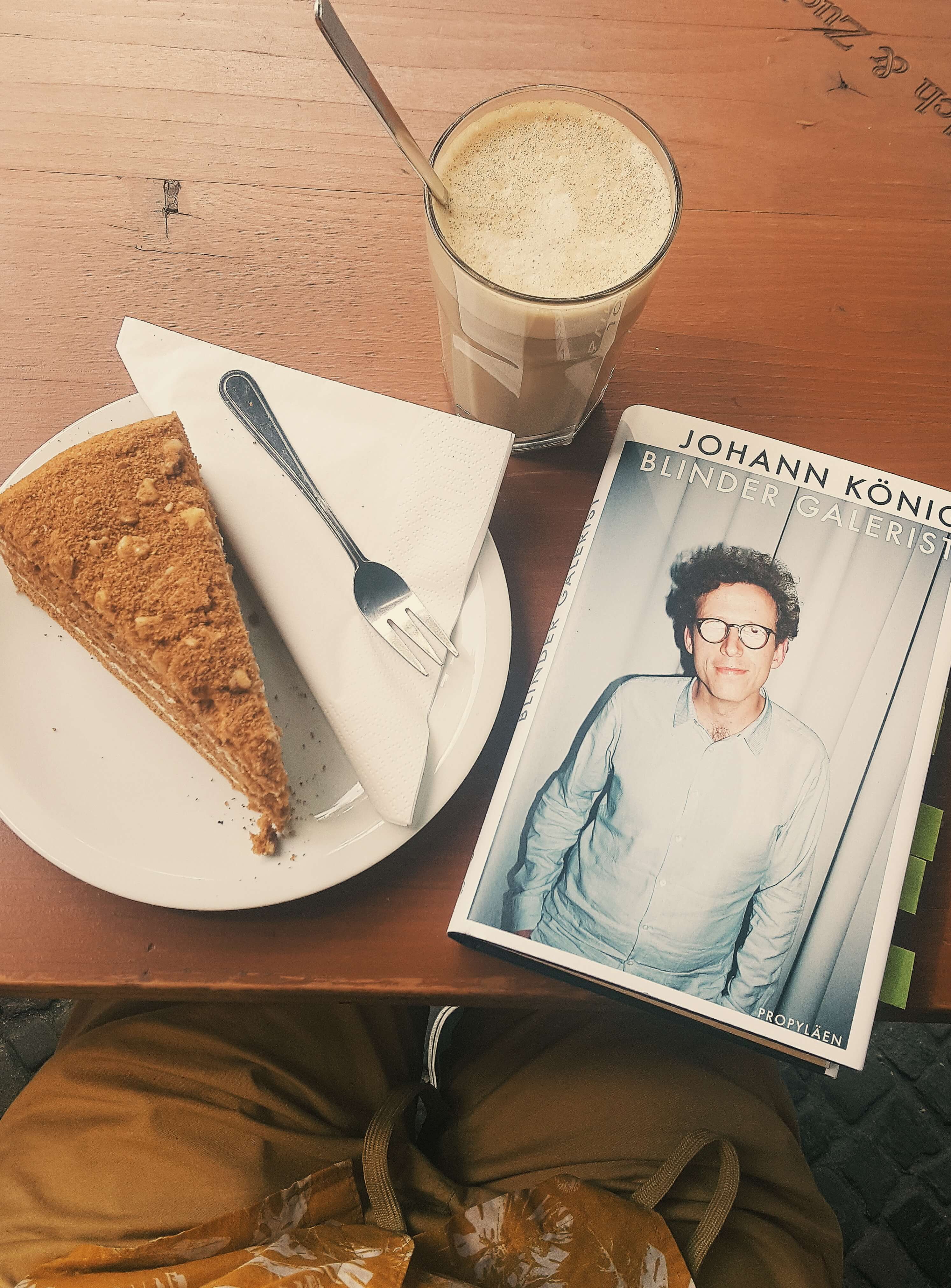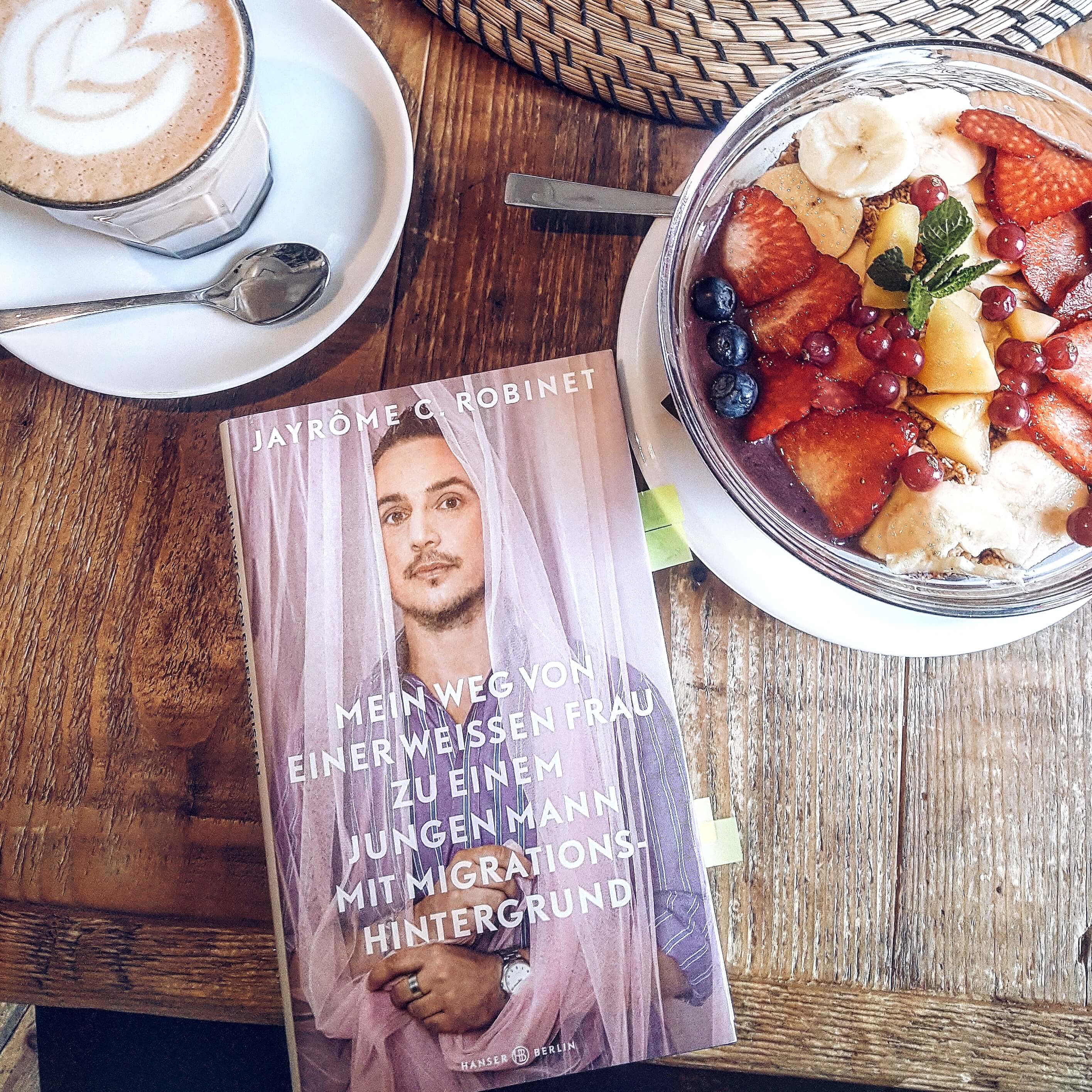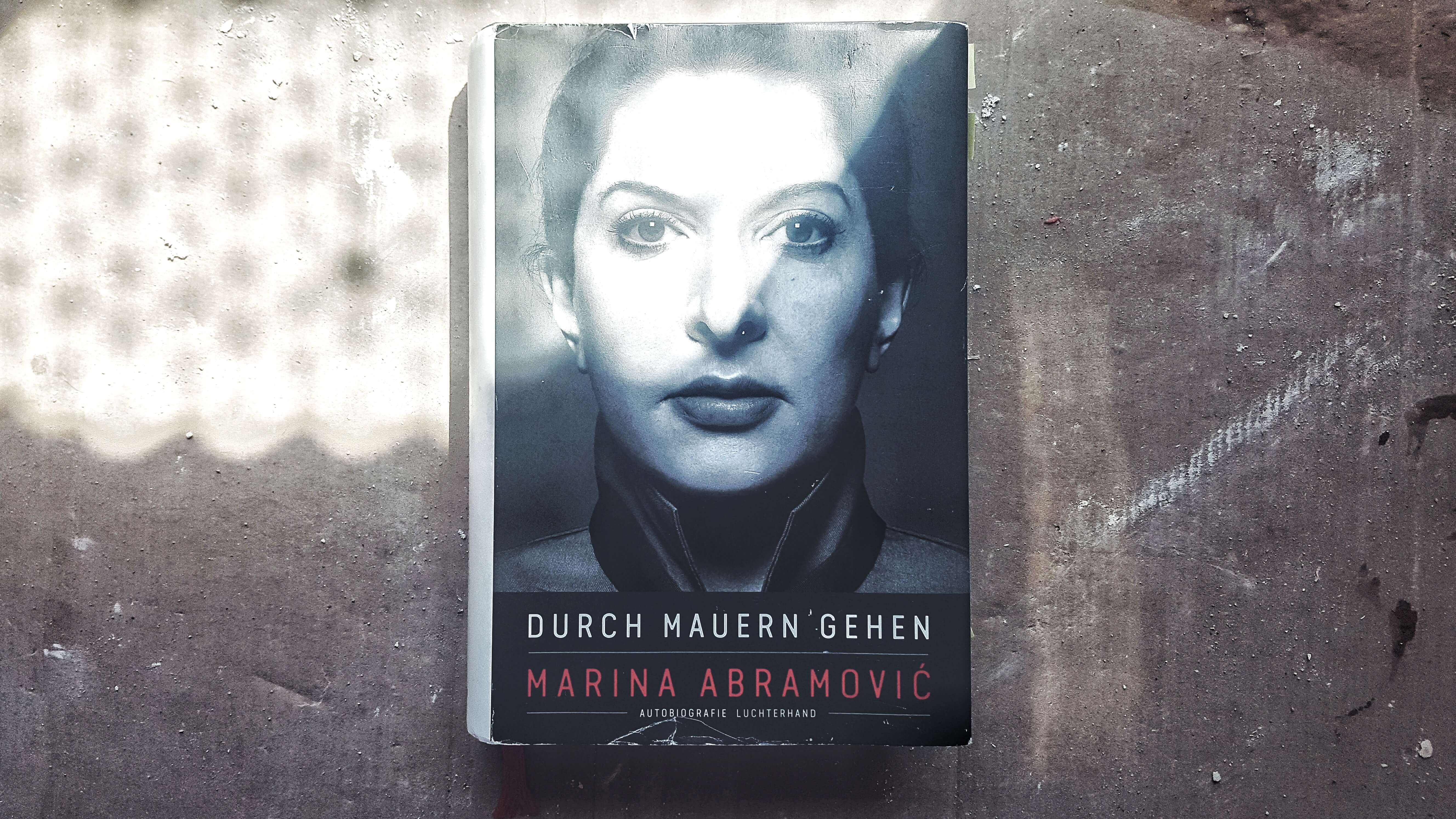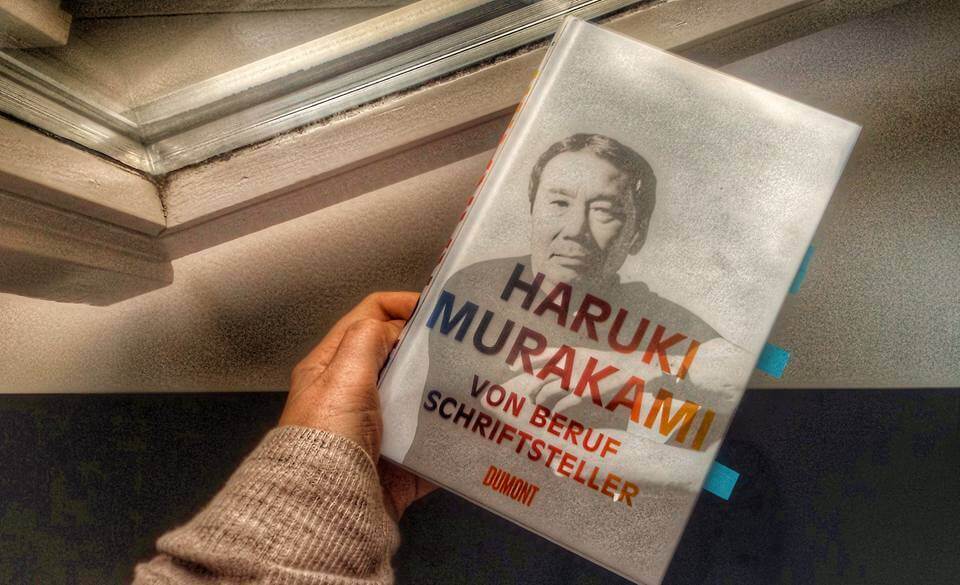Lori Gottlieb hat mit Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden ein lesenswertes Buch geschrieben, in dem sie nicht nur von ihrer eigenen Arbeit als Therapeutin erzählt, sondern auch von ihren Erfahrungen als therapeutische Patientin – entstanden ist dabei ein wichtiges und kluges Buch, das ich euch gerne allen ans Herz legen möchte!
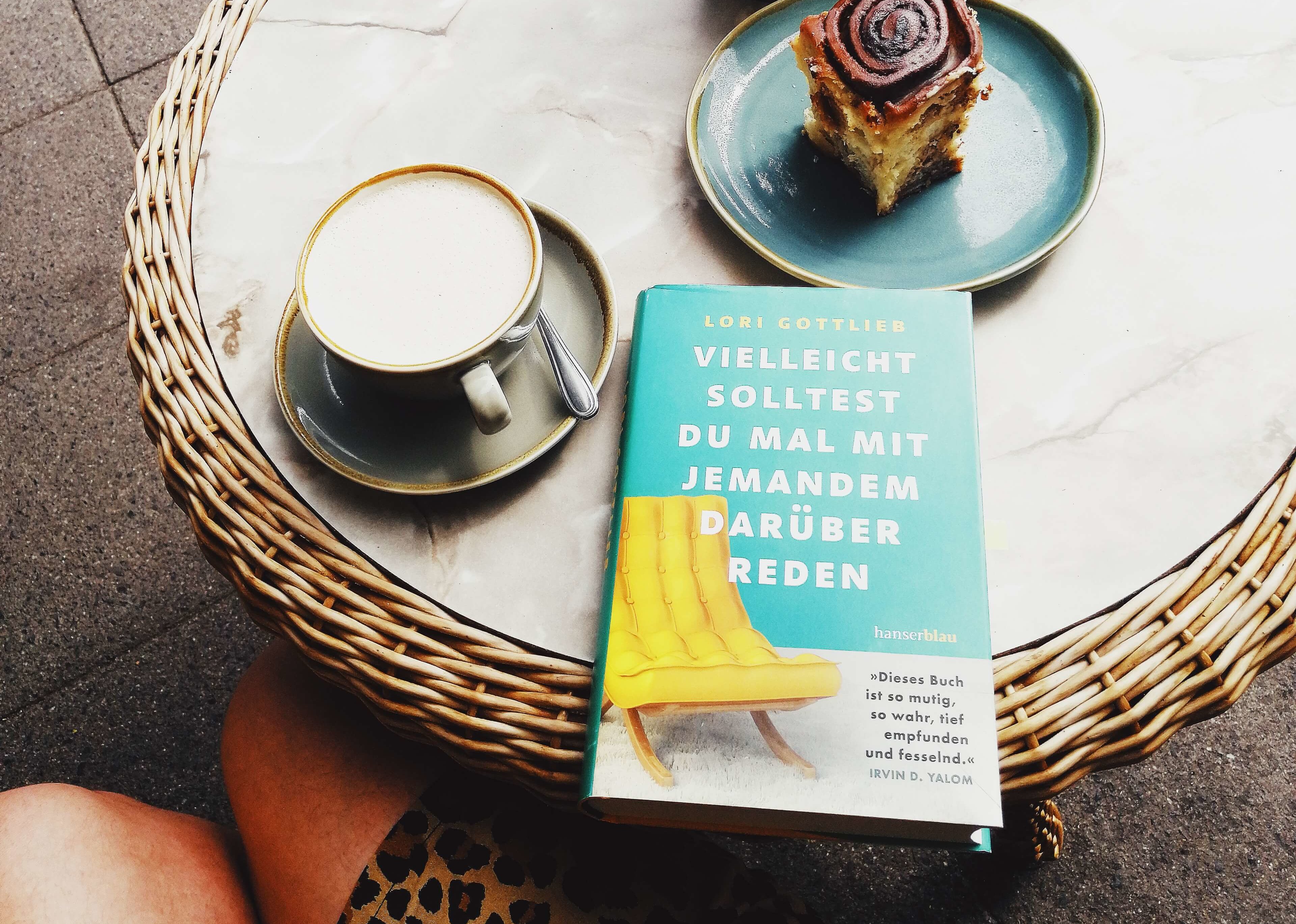
“Therapie ist wie Pornographie. Beides setzt eine gewisse Art von Nacktheit voraus. Beides kann großen Nervenkitzel auslösen. Und beides wird von Millionen Menschen in Anspruch genommen, die meisten behalten es jedoch lieber für sich.”
Bis Lori Gottlieb irgendwann Therapeutin wurde, ist einiges an Zeit vergangen, weil sie erst einmal ein paar Jahre gebraucht hat, um herauszufinden, was sie eigentlich im Leben machen möchte. Welche Arbeit macht mich glücklich? Welche Tätigkeit erfüllt mich? Ich war ein bisschen überrascht, als ich las, dass sie es zuerst im Fernsehen versuchte: sie arbeitete als Entwicklerin von so bekannten Serien wie Friends oder Emergency Room, später begann sie dann noch einmal zu studieren – irgendwann entschied sie sich schließlich dazu, als Therapeutin zu arbeiten.
Es ist spannend, was Lori Gottlieb über ihre Arbeit als Therapeutin schreibt: Wie können Therapeut*innen ihren Patient*innen überhaupt helfen? Wie behält man während einer Sitzung die Zeit im Auge? Und wie verhält man sich, wenn man Patient*innen überraschend außerhalb der Praxis trifft?
“Selbstverständlich schlagen Therapeuten sich genauso mit den täglichen Herausforderungen des Lebens herum wie alle anderen Menschen auch. Und es ist eben die Vertrautheit mit diesen Schwierigkeiten, aus der die Bande erwachsen, die wir zu Fremden knüpfen, die uns ihre schwierigsten Geschichten und Geheimnisse anvertrauen.”
Lori Gottlieb erzählt auch von ihren Patient*innen: da gibt es John, der für das Fernsehen Serien schreibt und es einfach nicht schafft, während den Sitzungen sein Handy aus der Hand zu legen. Er ist immer unhöflich, gestresst und auf dem Sprung, irgendwann fängt er sogar damit an, sich sein Mittagessen in die therapeutische Praxis liefern zu lassen. Lori Gottlieb kratzt in ihren Erzählungen ganz langsam den Schutzpanzer ab, den John sich umgelegt hat und dringt hinter diese Fassade aus Stress und ständiger Ablenkung. Da gibt es Julie, die eigentlich noch jung ist und ihr ganzes Leben vor sich hat, aber dann schwer an Krebs erkrankt. Da gibt es Rita, die Anfang 70 ist und den Kontakt zu ihren erwachsenen Kindern verloren hat – sie hat Angst davor, einsam zu sein, wenn sie älter wird.
Doch das Besondere an diesem Buch ist, dass Lori Gottlieb nicht nur Therapeutin ist, sondern auch Patientin: gleich zu Beginn des Buches erfahren wir, dass ihr Freund sie und ihr Kind sitzen lässt. Obwohl sie so glücklich mit ihm war, serviert er sie mit der Begründung ab, dass er die nächsten Jahre zwar gerne mit ihr verbringen würde, aber nicht mit ihrem Kind. Weil für Lori Gottlieb deshalb eine Welt zusammenbricht, sucht sie sich in ihrem Kummer therapeutische Unterstützung und findet Wendell, der sie durch diese schwierige Zeit hindurch begleitet.
“Die Leute denken immer, man gehe in Therapie, um Erklärungen zu finden, zum Beispiel warum der Freund mich verlassen hat oder warum jemand eine Depression entwickelt hat. In Wirklichkeit geht es in der Therapie um Erfahrung, etwas Einzigartiges, das zwischen zwei Menschen entsteht, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum einmal die Woche für eine Stunde sehen. Der Sinn dieser Erfahrung hat mir ermöglicht, auch anderswo Sinn zu finden.”
Was macht eine gute Therapie aus? Was lerne ich über mich selbst in einer Therapie? Das Buch umkreist auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder diese beiden zentralen Fragen. Lori Gottlieb schreibt sehr mitreißend, sehr empathisch – sie ist nicht nur eine tolle Therapeutin, sondern auch eine tolle Erzählerin. Das Buch ist eine lesenswerte Mischung aus Erzählungen und Fakten, vielleicht lässt es sich am treffendsten als erzählendes Sachbuch beschreiben.
Ich finde Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden aber auch noch aus anderen Gründen wichtig: ich glaube, dass therapeutische Hilfe immer noch ein Tabuthema ist und damit leider etwas, über das in unserer Gesellschaft viel zu oft geschwiegen wird. Ich glaube, dass dieses Buch einen wichtigen Teil dazu beitragen kann, das Thema Psychotherapie zu entstigmatisieren. Sich therapeutische Hilfe zu suchen ist keine Schwäche, sondern eine Stärke – darüber offen zu reden, macht es allen Menschen leichter, die gerade noch darüber nachdenken, ob sie sich auch Hilfe suchen sollten.
Mein einziger kleiner Kritikpunkt an der Übersetzung des Buches ist – ich muss es einfach ansprechen – die konsequente Verwendung des generischen Maskulinums: es gibt im Buch nur Therapeuten und Patienten, das finde ich schade und ich hoffe, dass das irgendwann auch nicht mehr zeitgemäß ist.
Lori Gottlieb: Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Aus dem amerikanischen Englisch von Elisabeth Liebl. Hanserblau, München 2020. 25€, 526 Seiten.