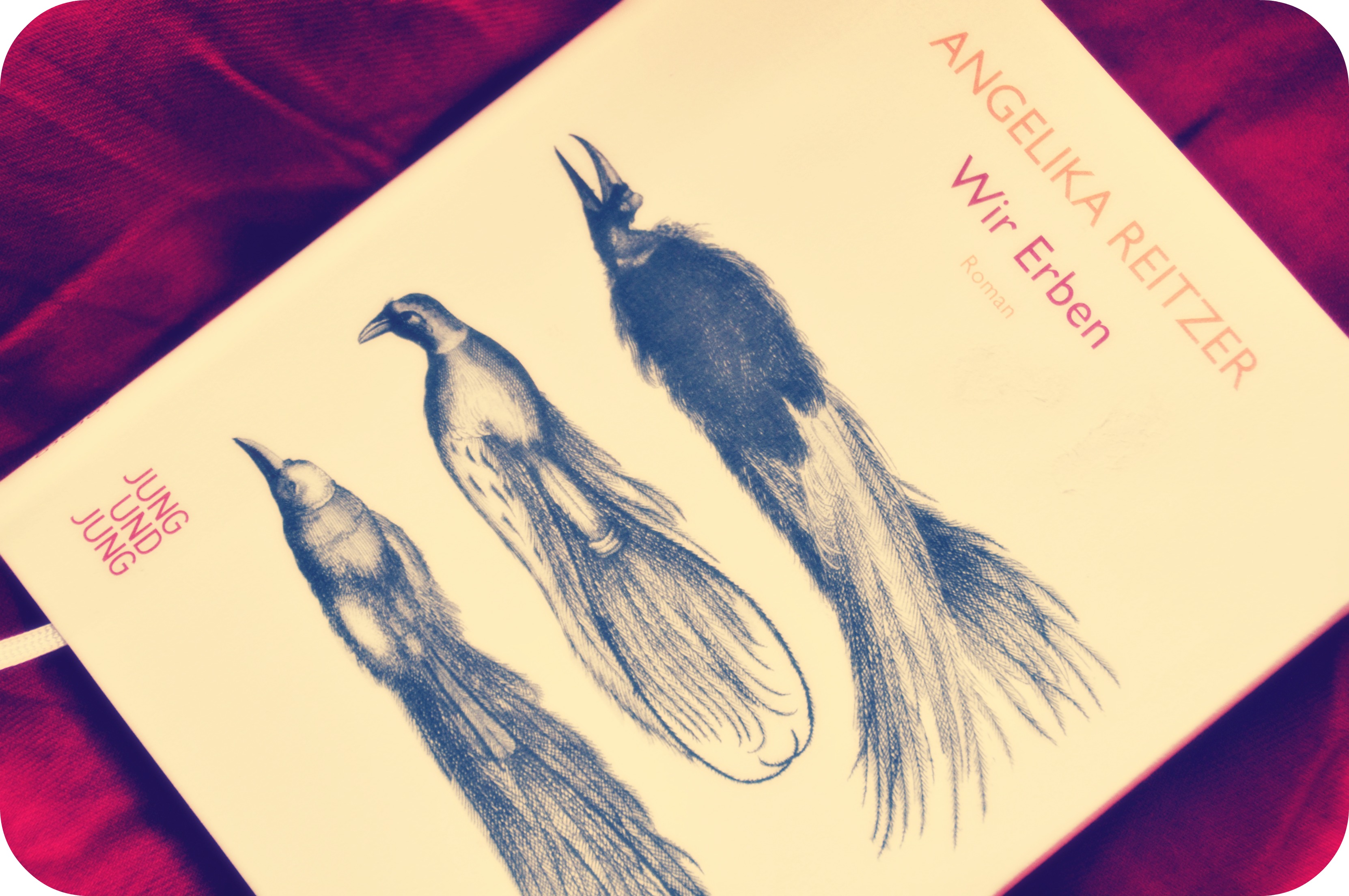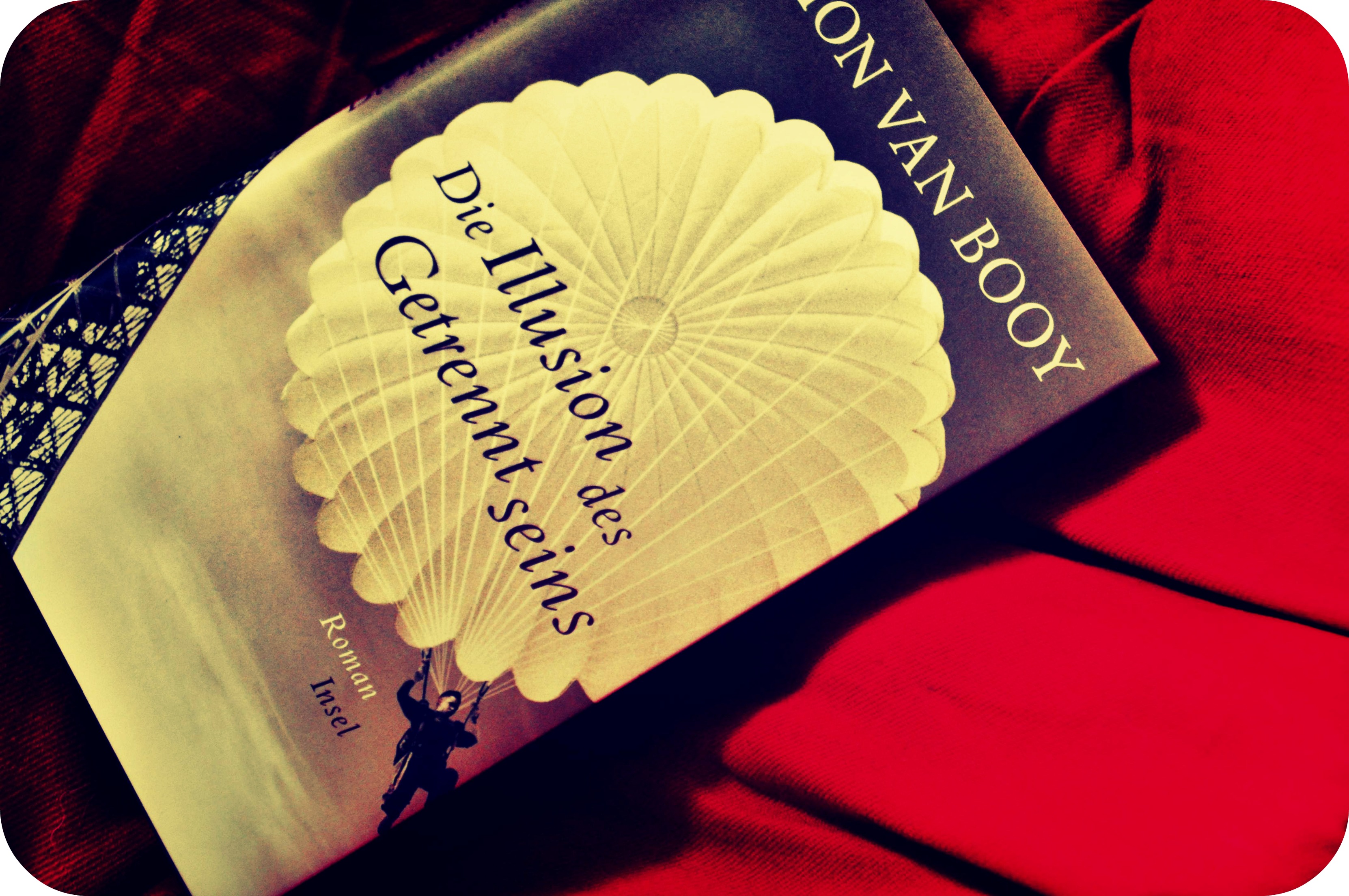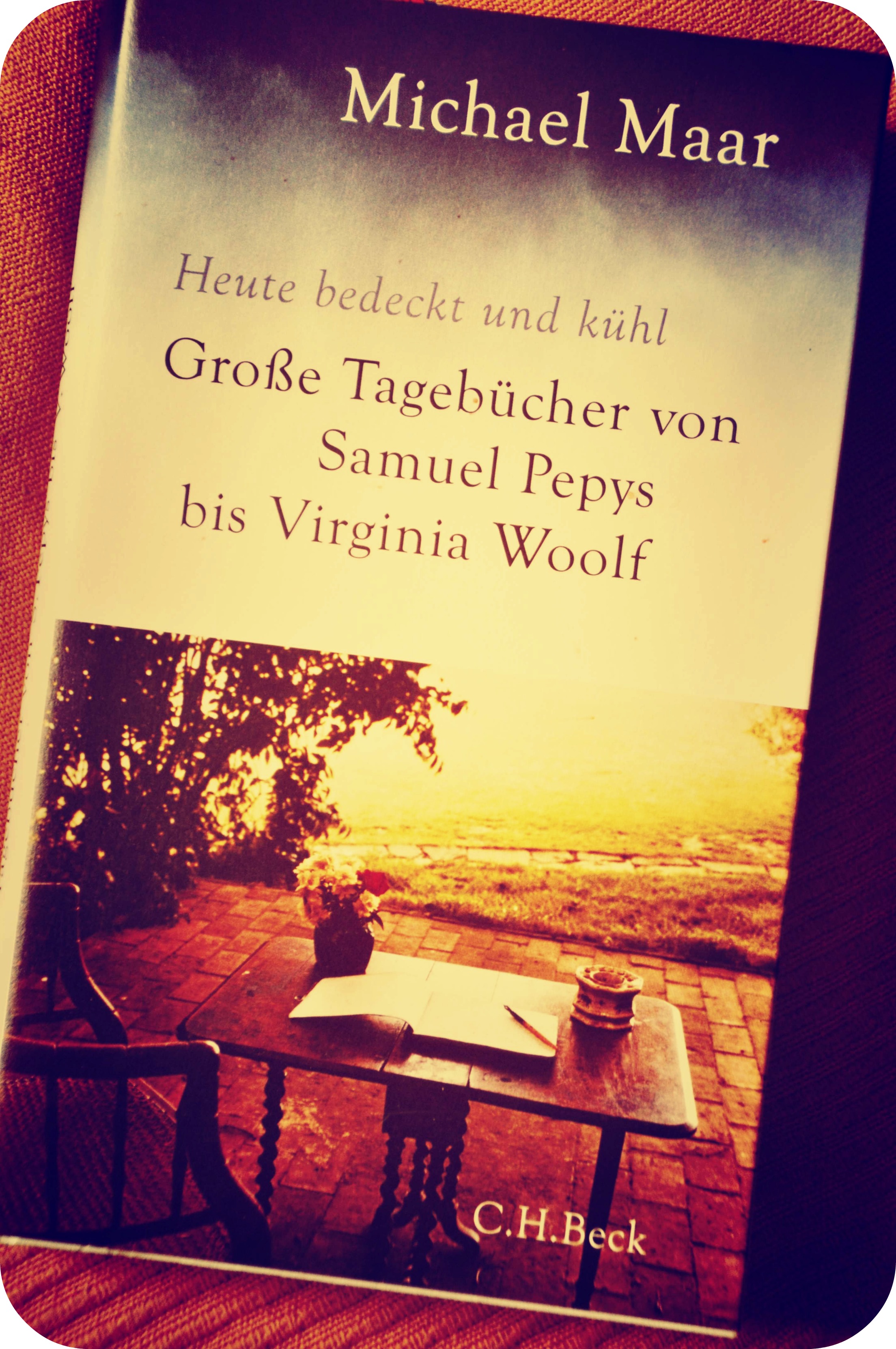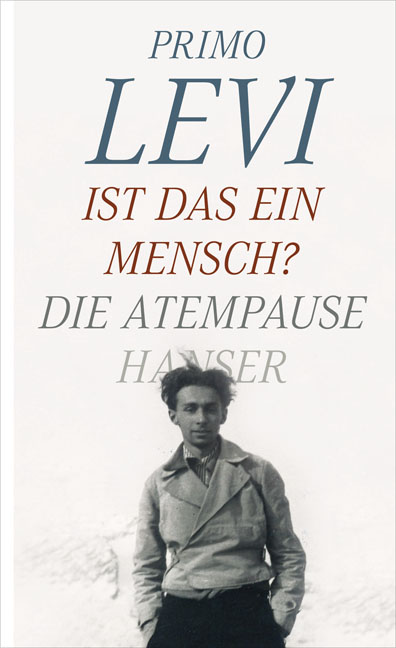Viola Ardone wurde 1974 in Neapel geboren und hat Literaturwissenschaften und klassischen Tanz studiert. Zehn Jahre lang war sie als Redakteurin in einem Verlag tätig, heute arbeitet sie hauptberuflich als Lehrerin an einem Gymnasium in Neapel und legt mit “Rezept für ein Herz in Aufruhr” ihren ersten Roman vor. Dieser wurde von Verena von Koskull übersetzt.
“Lässt sich ein Problem lösen, ist es kein Problem. Lässt es sich nicht lösen, ist es kein Problem mehr, hatte ihr Vater einmal gesagt.”
Dafne arbeitet als Architektin in Mailand, ihr Leben ist geordnet, sie ist eine selbstsichere Frau. Seit sie zehn Jahre alt ist, führt sie ein Tagebuch, voller Spalten und Zahlen – angeordnet in einer Excel-Tabelle, denn eins hat sie von ihrer frühen Kindheit an gelernt: eine äußere Ordnung, kann das innere Chaos besänftigen. Doch trotz all der Ordnung und trotz aller Sicherheit fehlt Dafne etwas im Leben, sie spürt einen nagenden Mangel, ein Loch in sich, das sie nicht füllen kann. Das Loch ist dort, wo eigentlich ihre Gefühle sein sollten. Die junge Frau hat nie gelernt, sich fallen zu lassen, sie hat nie gelernt, zu lieben, sie durfte es sich nie erlauben, jemanden Zutritt zu ihrem Leben zu gewähren. Statt zu fühlen, rechnet Dafne ihre Empfindungen in geometrische Daten und Formeln um. Diese Unfähigkeit hat ihre Wurzeln in Dafnes Kindheit, höchstwahrscheinlich, denn so wirklich erinnert sich Dafne nicht an die Zeit, in der sie Kind gewesen ist. Die Vergangenheit hat sie verdrängt, schön säuberlich weggepackt und in Excel-Listen abgelegt, so gut abgelegt, dass sie kaum noch einen Zugriff darauf hat.
“Die Mathematik der Gefühle hatte klare, strenge Regeln: Liebe war unteilbar und ließ sich nur multiplizieren. Ihr Zeichen war das Mal. Die Zeit war ein Plus, sie ließ sich nur addieren. Entscheidungen waren immer Subtraktion, ein Minus.”
Erst als Dafne den Mut dafür findet zurückzublicken, bekommt sie endlich auch die Möglichkeit zu sich selbst zu finden. Sie blick zurück auf das Mädchen, das sie gewesen ist, auf Dafne, wie sie als Kind gewesen ist. Der Blick zurück ist durchzogen mit einer zarten Traurigkeit. Die erwachsene Dafne gibt dem Kind eine Stimme, sie gibt dem Kind eine Sprache. Das, was das Mädchen zu erzählen hat, ist manchmal ergreifend, manchmal traurig, doch ab und an sind die Erinnerungen auch von einer fröhlichen Heiterkeit. Sie erinnert sich zurück an die Momente, in denen ein schweres Schweigen über der Familie lag, aber auch an fröhliche Momente, an gemeinsame Spiele und an ihren Lieblingsort, das Wasser. Das Wasser war immer ein Schutzraum für Dafne, ein Ort an dem sie nichts hören muss, ein Ort, an dem niemand sie finden kann. Die gleiche Schutzfunktion hat für sie die Geometrie, die die junge Frau wie eine Art Blase umschließt.
“Mein Zuhause ist anders. Alle Zuhauses sind gleich, nur meines nicht, das ist anders. Alles ist am falschen Platz. Meine Mama hat gesagt, wir seien originell. Aber Papa hat gesagt, er würde einfach nicht begreifen, wieso wir uns nicht benehmen können, wie andere Christenmenschen. Er ist nämlich ganz dick mit Gott befreundet.”
Mit der Männerwelt steht sie – es mag kaum überraschen – auf Kriegsfuß, doch dann ist Dafne plötzlich schwanger und wird zum ersten Mal von Gefühlen überflutet, die ihre ganzen Schutzmechanismen zum Wanken bringen … gemeinsam mit ihrer Psychologin Dottoressa Lorenzi begibt sie sich mutig und voller Zuversicht auf die Reise in ihre Vergangenheit.
Viola Ardone erzählt mit “Rezept für ein Herz in Aufruhr” einen dreigeteilten Roman: es gibt nicht nur die Ebene der Gegenwart, sondern auch die Erinnerungen an die Kindheit, diese Kindheitserinnerungen sind unvollständig, als würde ein Schleier über dem liegen, an das sich die junge Frau auf keinen Fall erinnern darf. Der Erzählstil dieser Erinnerungen ist kindlich, doch ich habe diesen kindlichen Ton immer als authentisch empfunden, nie als aufgesetzt oder unglaubwürdig. Schnell wird offensichtlich, dass Dafne sich Zugang zu diesem Ort verschaffen muss, den sie irgendwo in sich verschlossen hat, um in der Gegenwart endlich fühlen und leben zu können. Darüber hinaus gibt es immer wieder Passagen aus Dafnes Geometrie der Gefühle. Bei dieser Geometrie handelt es sich um eine Art Sammlung an Lebensweisheiten und amüsante Regeln zur Lebensführung.
“Während meine Mama isst und schweigt, denke ich, wenn nicht alles am falschen Platz wäre und jemand nicht was Falsches gesagt hätte, würden sie und ich jetzt zusammen spielen und sie würde mir sagen, ich solle aufhören, mit dem Saft zu blubbern und die Fischstäbchen zu zerpflücken.”
“Rezept für ein Herz in Aufruhr” klingt – wenn man allein den Titel betrachtet – nach einer seichten Liebesschnulze, doch dieser erste Eindruck täuscht zum Glück. Viola Ardone legt mit ihrem Romandebüt eine lesenswerte Reise in die Vergangenheit vor. Es geht um Gefühle, Erinnerungen und an das, was mit uns geschehen kann, wenn wir Dinge einfach nur verdrängen – irgendwann kommt alles wieder zurück und trifft dann mitten hinein in unser eigentlich so stabiles Leben. Ich habe mit “Rezept für ein Herz in Aufruhr” ein lesenswertes Romandebüt verschlungen, dem ich möglichst viele Leser wünsche!