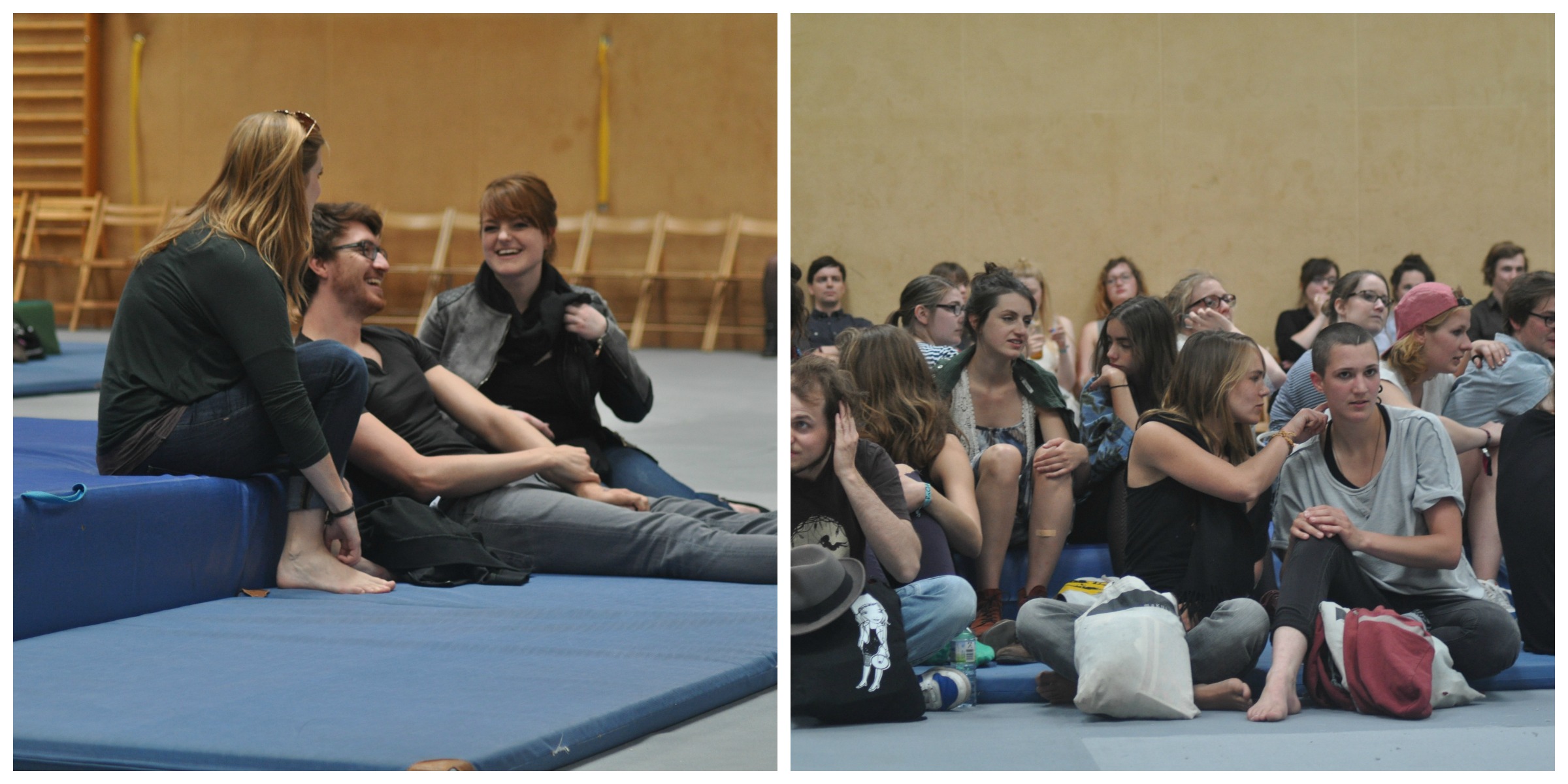Dana Buchzik ist nicht nur Bloggerin, die unter dem Pseudonym Sophia Mandelbaum auf Ze Zurrealism itzelf schreibt, sondern auch Literaturkritikerin, die u.a. für die Literarische Welt und die ZEIT arbeitet. Auf der Buchmesse in Frankfurt sorgte sie mit ihrem Fotoprojekt #sozialewärme für Aufsehen, außerdem rief sie vor kurzem zu einem #aufschrei in der Literatur auf und schrieb über ein misslungenes Interview mit Benjamnin Lebert.
Dana Buchzik ist nicht nur Bloggerin, die unter dem Pseudonym Sophia Mandelbaum auf Ze Zurrealism itzelf schreibt, sondern auch Literaturkritikerin, die u.a. für die Literarische Welt und die ZEIT arbeitet. Auf der Buchmesse in Frankfurt sorgte sie mit ihrem Fotoprojekt #sozialewärme für Aufsehen, außerdem rief sie vor kurzem zu einem #aufschrei in der Literatur auf und schrieb über ein misslungenes Interview mit Benjamnin Lebert.
Du schreibst u.A. für die Literarische Welt, die Süddeutsche und die ZEIT über Literatur und gleichzeitig auch an deinem eigenen Roman. An welcher der beiden Tätigkeiten hast du mehr Freude?
Glücklicherweise macht mich beides glücklich 🙂 Ich liebe die journalistische Arbeit sehr, weil ich nicht zuletzt dafür bezahlt werde, großartige Bücher zu lesen und spannenden Persönlichkeiten zu begegnen. Das literarische Schreiben begleitet mich schon lange und ist eine Art Grundbedürfnis. Wenn ich vor lauter Arbeit längere Zeit nicht dazu komme, fehlt es mir und ich fühle mich nicht mehr vollständig, so kitschig oder esoterisch das klingt/ist.
In Hildesheim hast du am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft studiert. Wie kam es dazu, dass du den Wunsch entwickelt hast, zu schreiben?
Wahrscheinlich sagt hier jeder das Gleiche, auch ich: Das Schreiben begleitet mich, seit ich denken kann. 2009 war ich an einem Punkt, an dem ich so konsequent sein wollte, diesem großen Thema meines Lebens auch (m)ein Studium zu widmen – eine Entscheidung, die ich glücklicherweise nicht bereut habe.
Hat das Studium dein Schreiben verändert oder beeinflusst? Was hast du aus der Zeit in Hildesheim mitgenommen?
Kurz nach Studienbeginn sagte man mir: Nach dem ersten Semester wirst du alles wegwerfen und verachten, was du vor diesem Studium geschrieben hast. Ich wollte das nicht glauben, aber er hatte Recht. Das Studium in Hildesheim hat mich weiter gebracht, als ich es je für möglich gehalten hätte. Aber nicht nur das Schreiben selbst hat sich verändert, sondern auch mein Blick darauf. Ich habe gelernt, es ernster zu nehmen, habe begonnen, es als „Arbeit“ zu bezeichnen, nicht nur als kleine, irrelevante Spielerei, über die man nur beschämt oder durchironisiert sprechen kann.
Du schreibst momentan an deinem eigenen Roman und betreibst auch einen eigenen Blog, auf dem du Texte von dir veröffentlichst. Welche Themen treiben dich beim Schreiben um?
Ausgangspunkt sind zumeist Themen, die Freunde, Bekannte oder mich selbst bewegen; von dort aus entwickeln sich kleine Geschichten, Eindrücke, Assoziationen; als virtuelles Tagebuch ist es also nicht gemeint.
Die Artikel in deinem Blog veröffentlichst du unter dem Namen Sophia Mandelbaum, was hat es damit auf sich?
Ich bin ja schon eine ganze Weile im Internet unterwegs und habe immer nach einem Pseudonym gesucht, mit dem ich mich identifizieren kann. Sophia Mandelbaum kam mir spontan in den Sinn und blieb haften. Ich mag das Weiche und Blumige dieses Namens, im Gegensatz zu meinem Klarnamen, der eher hart und kantig klingt.
In den vergangenen Wochen hast du mit zwei Artikeln Aufmerksamkeit erregt: du hast zum einen zu einem literarischen Aufschrei aufgerufen. Was hat dich zu diesem Aufschrei motiviert? War die Veröffentlichung der Longlist der Auslöser oder hat dich das Thema schon länger umgetrieben?
Die Longlist war sicherlich ein Auslöser, aber das Thema Sexismus im Literaturbetrieb beschäftigt mich schon länger und ich war (und bin) froh, dass sich die Gelegenheit auftat, ein paar grundsätzliche Gedanken zu dem strukturellen Ungleichgewicht zu formulieren, das ich im Betrieb wahrnehme. Die „Old Boys Networks“, wie Annina Luzie Schmid sie im Artikel genannt hat, sind ein sehr reales Problem, das Frauen im Mittelfeld festhält und Männer nach oben katapultiert. Dieses Thema muss auf den Tisch, wieder und wieder, bis sich etwas geändert hat, zum Besseren, hin zu mehr Chancengleichheit. Ich fordere übrigens keine Quote, auch wenn Journalistenkollegen mich mehrheitlich damit „zitieren“, sondern ich plädiere für mehr Transparenz, für mehr Nach- und Hinterfragen und für offene(re) Diskussionen. Ich möchte gern darauf vertrauen, dass wir auch ohne Quotendruck in der Lage sind, veraltete Denk- und Verhaltensmuster aufzubrechen.
Der Artikel ist nicht nur in der gedruckten Ausgabe erschienen, sondern auch online. Soziale Netzwerke haben es an sich, dass Menschen viel unmittelbarer reagieren können. Hast du alle Kommentare gelesen, die zu deinem Artikel eingegangen sind?
Nein, das wäre zum Einen angesichts der schieren Menge kaum machbar gewesen – zum Anderen halte ich die Lektüre von Onlinekommentaren nicht für sonderlich produktiv.
Was hast du für Methoden, um dich vor dieser Öffentlichkeit schützen zu können?
Online-Kommentare lese ich, wie gesagt, nicht; wenn man bei Facebook verlinkt oder direkt angeschrieben wird, poppt das natürlich auf und ins Bewusstsein. Mich haben teils genau solche Anfeindungen erreicht, wie ich sie im Artikel geschildert hatte, was mich anfangs hat schlucken lassen, aber, um Helen Lewis zu zitieren: „The comments on any article about feminism justify feminism” – und bis der nächste Artikel erscheint, der Facebook„freunde“ und –fremde zu Respektlosigkeiten inspiriert, trainiere ich einfach meine Block-Kompetenz 🙂
Der Artikel über das misslungene Interview mit Benjamin Lebert habe ich als etwas Außergewöhnliches im Literaturbetrieb empfunden. Warum hast du dich entschieden, den Artikel zu veröffentlichen und nicht über das Gespräch zu schweigen?
Ich glaube, dass auch im scheinbar Missglückten etwas aufscheinen und sichtbar werden kann. Das Interview mit Benjamin Lebert habe ich, auch wenn das paradox erscheinen mag, als sehr positiv in Erinnerung. Man reibt sich aneinander, manchmal scheitert man auch aneinander, und gerade deswegen können Begegnungen besonders und lehrreich sein. Wieso soll man über etwas schweigen, nur weil es nicht perfekt gelaufen ist?
Wie ergeht es dir da überhaupt als Literaturkritikerin? Ich muss gestehen, dass ich eindeutig mehr Freude daran habe, Bücher zu loben. Fallen dir Verrisse schwer?
Am schwersten fallen mir Besprechungen von Büchern, die ich als langweilig, als mittelmäßig erlebe; Loben oder Verreißen finde ich nicht schwierig. Ich schätze mich glücklich, in meiner journalistischen Arbeit nichts schönreden zu müssen, sondern klar und ehrlich sein zu dürfen. Daniela Strigl hat unlängst etwas sehr Schönes zu diesem Thema gesagt:
„Ich glaube, dass man als Literaturkritiker auch Verrisse schreiben muss. Das bin ich den herausragenden Büchern schuldig. Wenn ich alles lau und mittelgut bewerte, ist alles eins. Kritik heißt Farbe bekennen.“
Kannst du uns abschließend noch deine drei Büchertipps für den Literaturherbst verraten?
Sehr gern! Stephanie Bart: Deutscher Meister, Karen Köhler: Wir haben Raketen geangelt und Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe.
Foto: © Christopher Weber