Lena Dunham legt mit Not that kind of girl ein seltsames Buch vor. Es ist ein buntes Sammelsurium, das aus Essays, Anekdoten, E-Mails und langen Listen besteht. Doch diesen Versatzstücken, die mal unterhaltsam und mal traurig sind, fehlt auf den ersten Blick der Kleber, der alles zusammenhält. Sie präsentieren sich als bröselige Bruchstücke, denen alles fehlt, was eine gute Geschichte ausmacht. Das Buch konnte ich trotzdem nicht aus der Hand legen …
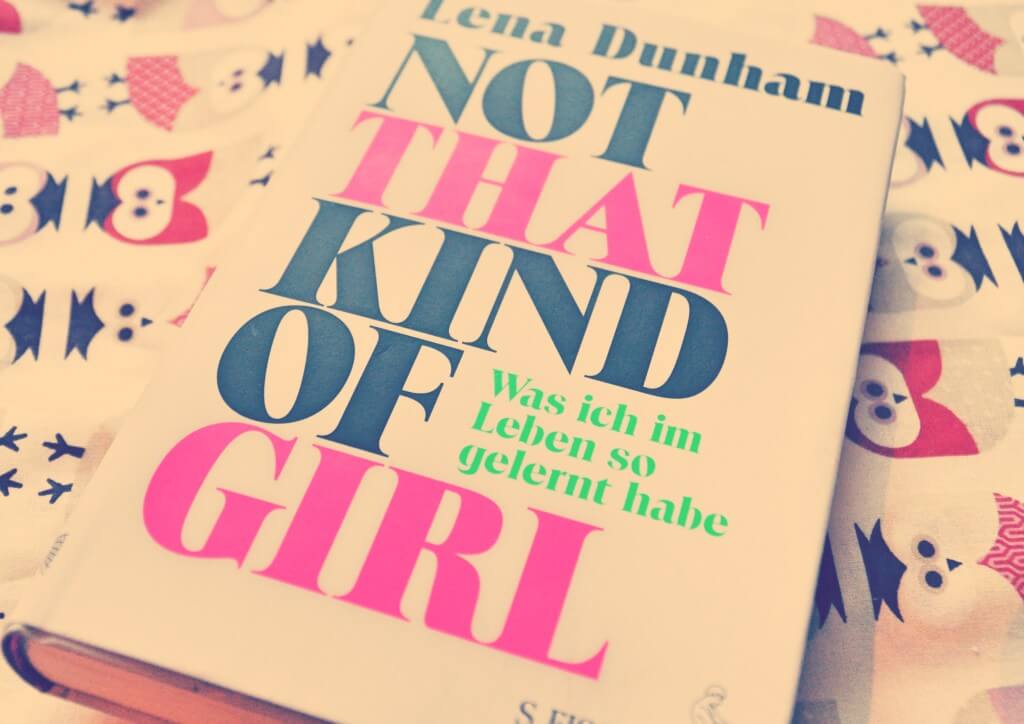
Ich glaube, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die Lena Dunham nicht gekannt haben – erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie mit der Fernsehserie Girls berühmt geworden ist. Sie hat die Serie nicht nur geschrieben und produziert, sondern sie hat auch Regie geführt und spielt darin die Hauptrolle. Vor zwei Jahren wurde sie auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt und vom Time Magazine zur Coolest Person of the Year gekürt. All das mit gerade einmal achtundzwanzig Jahren.
Not that kind of girl erinnert in der Hinsicht an die Fernsehserie Girls, dass auch hier alles um Lena Dunham kreist – wenn man sich auf einen Themenschwerpunkt festlegen wollen würde, dann wäre es wohl Lena Dunham, in allen Facetten. Sicherlich ist das bei einem autobiographischen Erinnerungsbuch (das wahrscheinlich aber auch fiktional angehaucht ist) nicht ungewöhnlich, doch wie sehr die Autorin um sich und ihr Leben kreist, ist mitunter dann doch ein wenig verstörend: es geht (natürlich) um Liebe und Sex, um die schönen und ekligen Seiten des eigenen Körpers, um Freundschaften, die Arbeit und zwischendurch auch mal um das große Ganze (Ängste, Krankheiten, das Sterben). Es ist eine bunte Mischung, der jede Verbindung fehlt, der Anfang und Ende fehlt, ganz zu schweigen von so etwas wie einem Erzählfaden: Lena Dunham ist mal vier, mal neunzehn, mal neun, mal elf Jahre alt. Beim Lesen hatte ich zwischendurch das Gefühl, dem Redeschwall eines hyperaktiven Kindes zuzuhören. ADHS in Papierform.
Man sieht mir das alles nicht an, wenn ich auf Partys gehe. Unter Leuten bin ich gnadenlos komisch, aufgetakelt in Second-Hand-Kleidern, mit aufgeklebten Fingernägeln, im ewigen Kampf gegen die Müdigkeit von 350mg Tabletten, die ich abends nehme. Ich tanze am wildesten, lache am lautesten über meine eigenen Witze und rede von meiner Vagina wie andere über ihr Auto oder ihre Kommode.
Doch trotz allem: einmal angefangen konnte ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen, ich habe es an einem Sonntagnachmittag in einem Rutsch gelesen und habe alles andere darüber vergessen. Es ist leicht Not that kind of girl nicht zu mögen, es ist dagegen sehr viel schwieriger herauszufinden, warum man dieses seltsame Buch mögen könnte. Wenn man von Not that kind of girl all die selbstbezogene Geschwätzigkeit abkratzt, bleibt darunter nicht viel übrig, doch das, was übrig bleibt, hat mich fasziniert: Lena Dunham ist für ihr junges Alter eine wahnsinnig erfolgreiche Frau, doch dieser Erfolg hat sie in ihrem Inneren kein bisschen selbstsicherer, glücklicher oder zufriedener gemacht. Diesem Erfolg gingen sogar zahlreiche Fehler voraus, viele dunkle Momente und Stunden, ganz viel Unsicherheit und Unzufriedenheit.
[…] ich will meine Geschichten erzählen, mehr noch, ich muss es tun, um nicht wahnsinnig zu werden: Geschichten darüber, wie es ist, morgens in meinem erwachsenen Frauenkörper aufzuwachen, voller Angst und Ekel. Wie es sich anfühlt, bei einem Praktikum den Arsch getätschelt zu bekommen, mich in Meetings vor lauter fünfzigjährigen Männern beweisen zu müssen und zu einer Abendveranstaltung mit der schlimmsten Rotznase zu gehen, die die Welt je gesehen hat.”
Wir lernen in Not that kind of girl ein neurotisches Mädchen kennen, das sich selbst bemitleidet. Ein Mädchen, das kaum Freunde hat, sich hässlich fühlt und mit Jungs schläft, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dazuzugehören. Ohne Scham erzählt Lena Dunham von ihren Versuchen, nicht nur Gewicht zu verlieren (Versuche, die häufig in Fressattacken enden), sondern auch ihre Jungfräulichkeit. Sie erzählt von der Abneigung, die sie empfunden hat, als ihre jüngere Schwester geboren wurde. Sie erzählt wenig von ihrem heutigen Erfolg, im Zentrum stehen vielmehr die Ängste, die sie überwinden musste, um überhaupt das Selbstbewusstsein dafür zu haben, kreativ zu sein und erfolgreich zu werden. Und trotz des Erfolgs ist dieses Selbstbewusstsein auch heute noch fragil und leicht angreifbar. Viele ihrer Geschichten sind natürlich auch unterhaltsam und mitunter hochkomisch, doch die Anekdoten und Essays von Lena Dunham funktionieren dort am besten, wo sie sich mit ihren Themen ernsthaft und mit großer Ehrlichkeit auseinandersetzt. An anderen Stellen hatte ich das Gefühl, mussten Lücken gefüllt werden: 13 Dinge, die man besser nicht zu seinen Freunden sagt; 10 Gründe, warum ich New York liebe; 15 Dinge, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Diese Listen sind nicht nur banal, sondern auch von zweifelhafter literarischer Qualität.
Nein, ich bin keine Sexpertin, keine Psychologin, keine Ernährungswissenschaftlerin. Ich bin keine Mutter von drei Kindern oder die Besitzerin eines erfolgreichen Strumpfhosenimperiums. Ich bin eine junge Frau mit dem ausgeprägten Interesse zu bekommen, was mir zusteht, und was hier folgt, sind die hoffnungsvollen Nachrichten von der Front, an der ich dafür kämpfe.
Not that kind of girl ist ein schwieriges Buch, das ich keinesfalls empfehlen kann und möchte. Doch wem es gelingt, nicht nur die einzelnen Anekdoten zu sehen, sondern hinter diese Fassade zu schauen, der hat vielleicht ein ähnliches Leseerlebnis wie ich: ich habe ein keinesfalls perfektes Buch gelesen, das von einer mutigen Autorin geschrieben wurde, die ganz ohne Scham dazu einlädt, aus ihren Fehlern zu lernen und dabei vielleicht sich selbst ein Stückchen näher zu kommen – auch auf die Gefahr hin, plötzlich der eigenen Versicherung und Verletzlichkeit ebenso wie seinen Ängsten gegenüberzustehen.

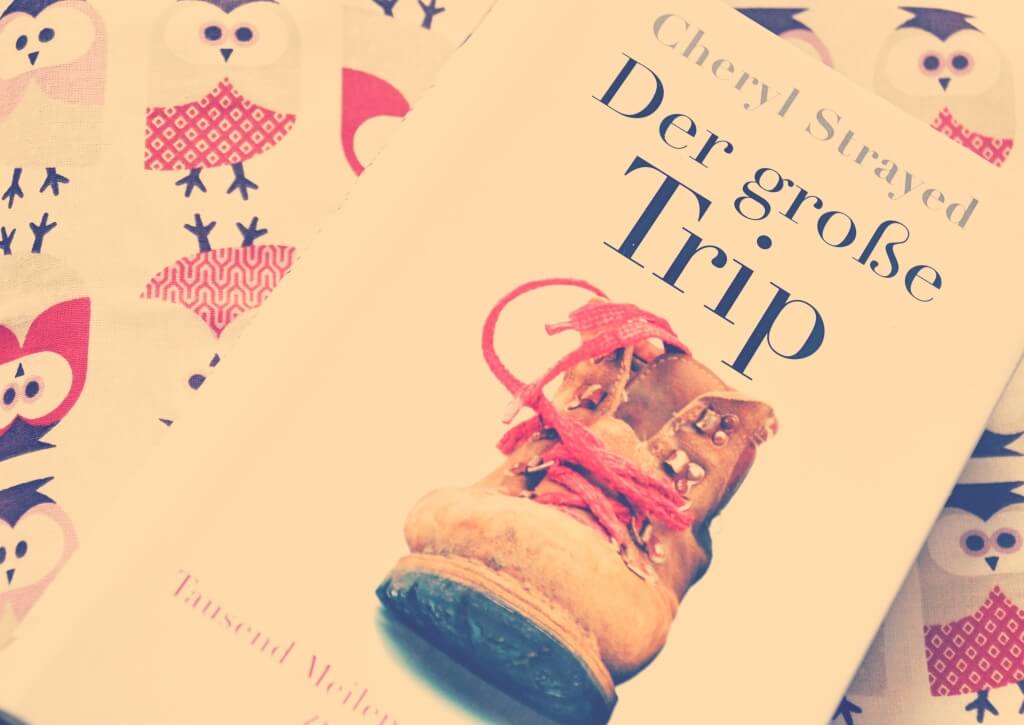
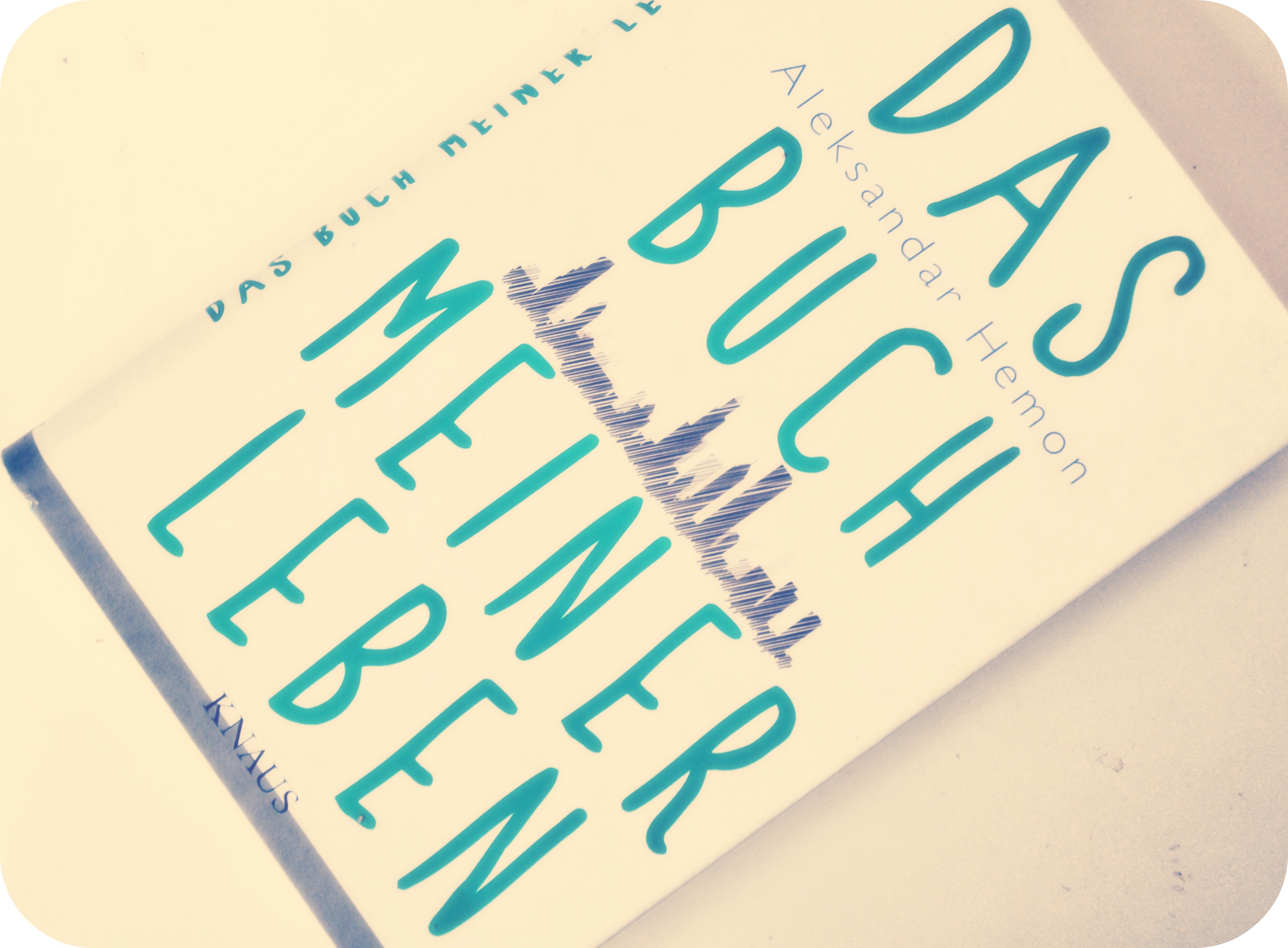
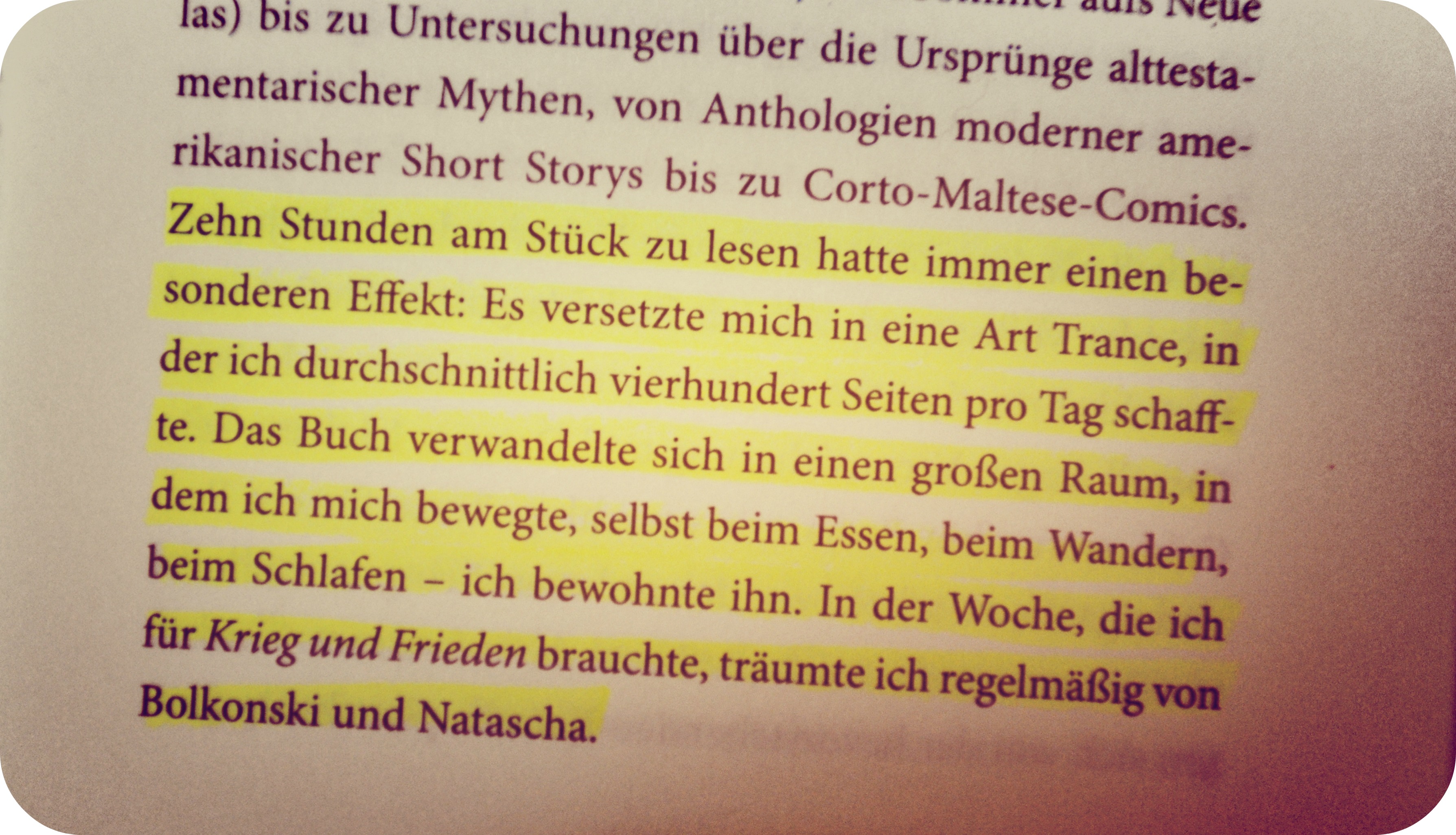
 Christoph Schlingensief wurde 1960 in Oberhausen geboren und hat als Film-, Theater- und Opernregisseur gearbeitet. 2008 wurde bei Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert und er thematisierte seine Krebserkrankung in dem Tagebuch “So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein”. In diesem Buch gelingt es Schlingensief auf beeindruckende Art und Weise, der Sprachlosigkeit, die einer Krebsdiagnose folgt, wieder eine Sprache zu geben; die Ohnmacht in Worte zu kleiden. “So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein” ist ein beeindruckendes und gleichzeitig auch ein schrecklich schwer auszuhaltendes und vor allem auch ein erschütterndes Buch, das dennoch sehr viel Mut machen kann. In den folgenden zwei Jahren, bis zu seinem Tod am 21. August 2010, arbeitete Schlingensief überwiegend an der Realisierung seiner Idee für ein “Operndorf Afrika”, bei dessen Grundsteinlegung im Februar 2010 in Burkina Faso er noch dabei sein konnte.
Christoph Schlingensief wurde 1960 in Oberhausen geboren und hat als Film-, Theater- und Opernregisseur gearbeitet. 2008 wurde bei Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert und er thematisierte seine Krebserkrankung in dem Tagebuch “So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein”. In diesem Buch gelingt es Schlingensief auf beeindruckende Art und Weise, der Sprachlosigkeit, die einer Krebsdiagnose folgt, wieder eine Sprache zu geben; die Ohnmacht in Worte zu kleiden. “So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein” ist ein beeindruckendes und gleichzeitig auch ein schrecklich schwer auszuhaltendes und vor allem auch ein erschütterndes Buch, das dennoch sehr viel Mut machen kann. In den folgenden zwei Jahren, bis zu seinem Tod am 21. August 2010, arbeitete Schlingensief überwiegend an der Realisierung seiner Idee für ein “Operndorf Afrika”, bei dessen Grundsteinlegung im Februar 2010 in Burkina Faso er noch dabei sein konnte.
 “Wie werde ich reagieren, wenn der Tod kommt, wenn er vor mir steht? Alles, was ich gelernt habe, was ich seit zwanzig Jahren praktiziere, all die Vorbereitungen in Erwartung des Endes – wird es die Konfrontation mit der Realität aushalten?”
“Wie werde ich reagieren, wenn der Tod kommt, wenn er vor mir steht? Alles, was ich gelernt habe, was ich seit zwanzig Jahren praktiziere, all die Vorbereitungen in Erwartung des Endes – wird es die Konfrontation mit der Realität aushalten?” “Diese Erinnerungen sind eine Pilgerreise.”
“Diese Erinnerungen sind eine Pilgerreise.”