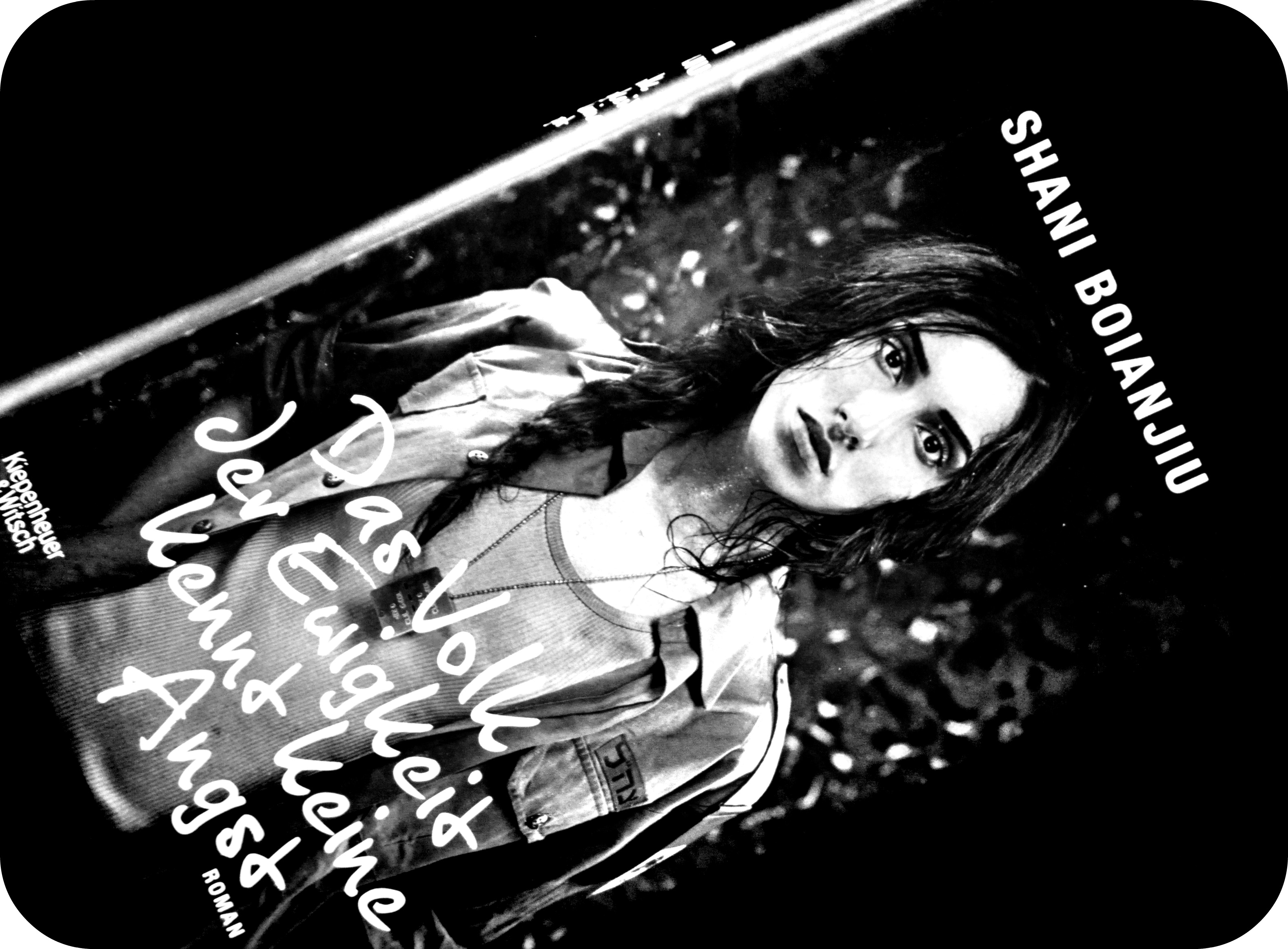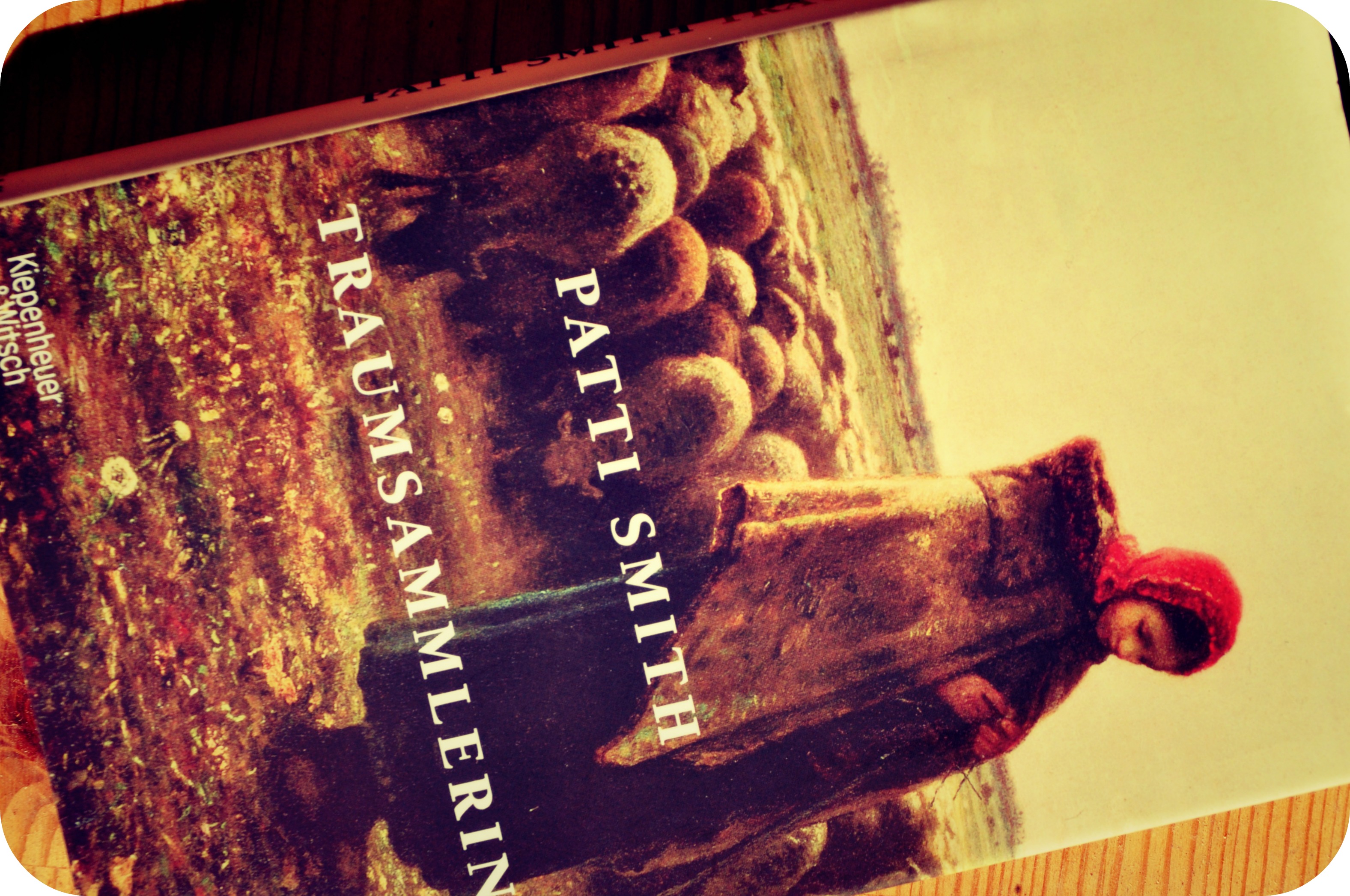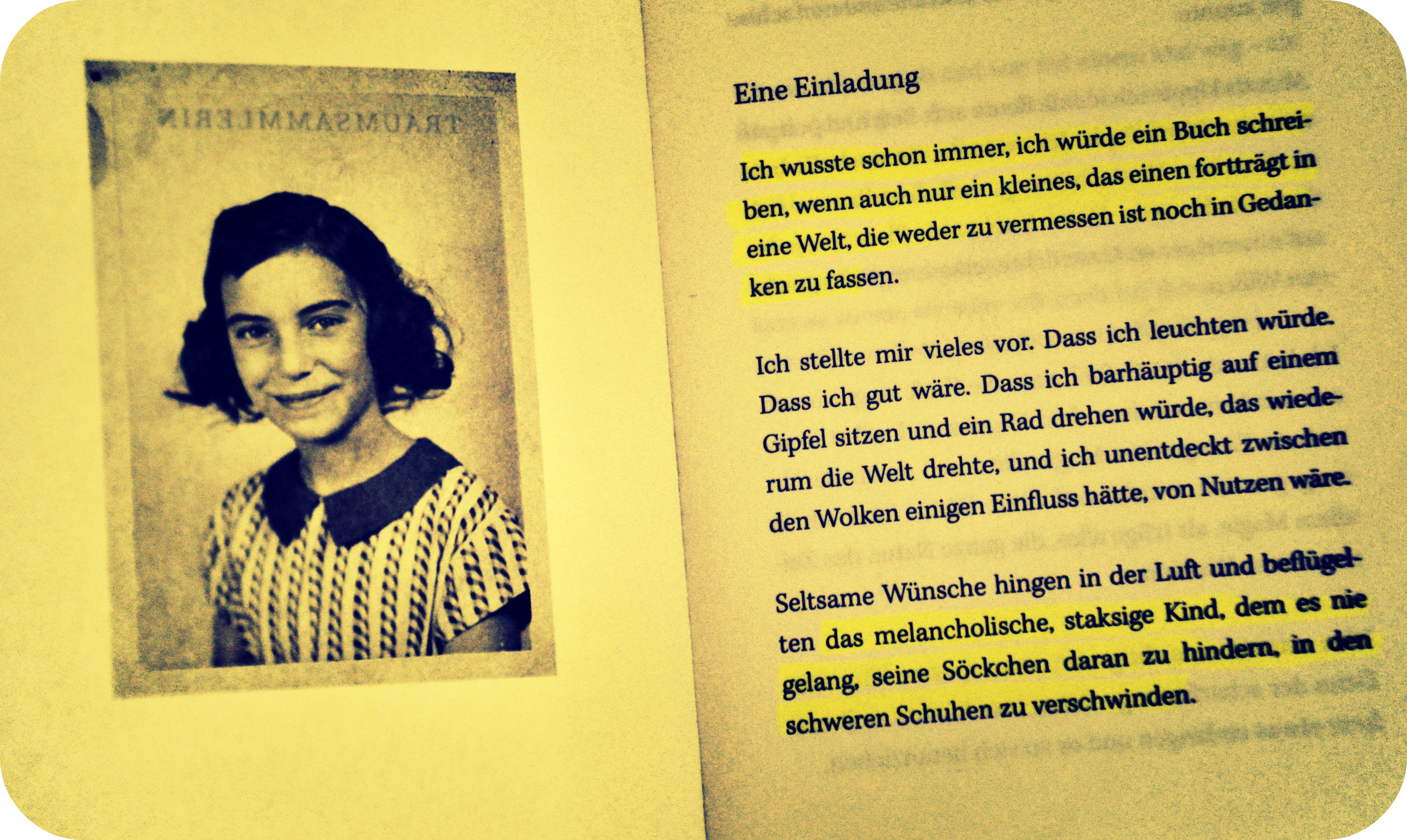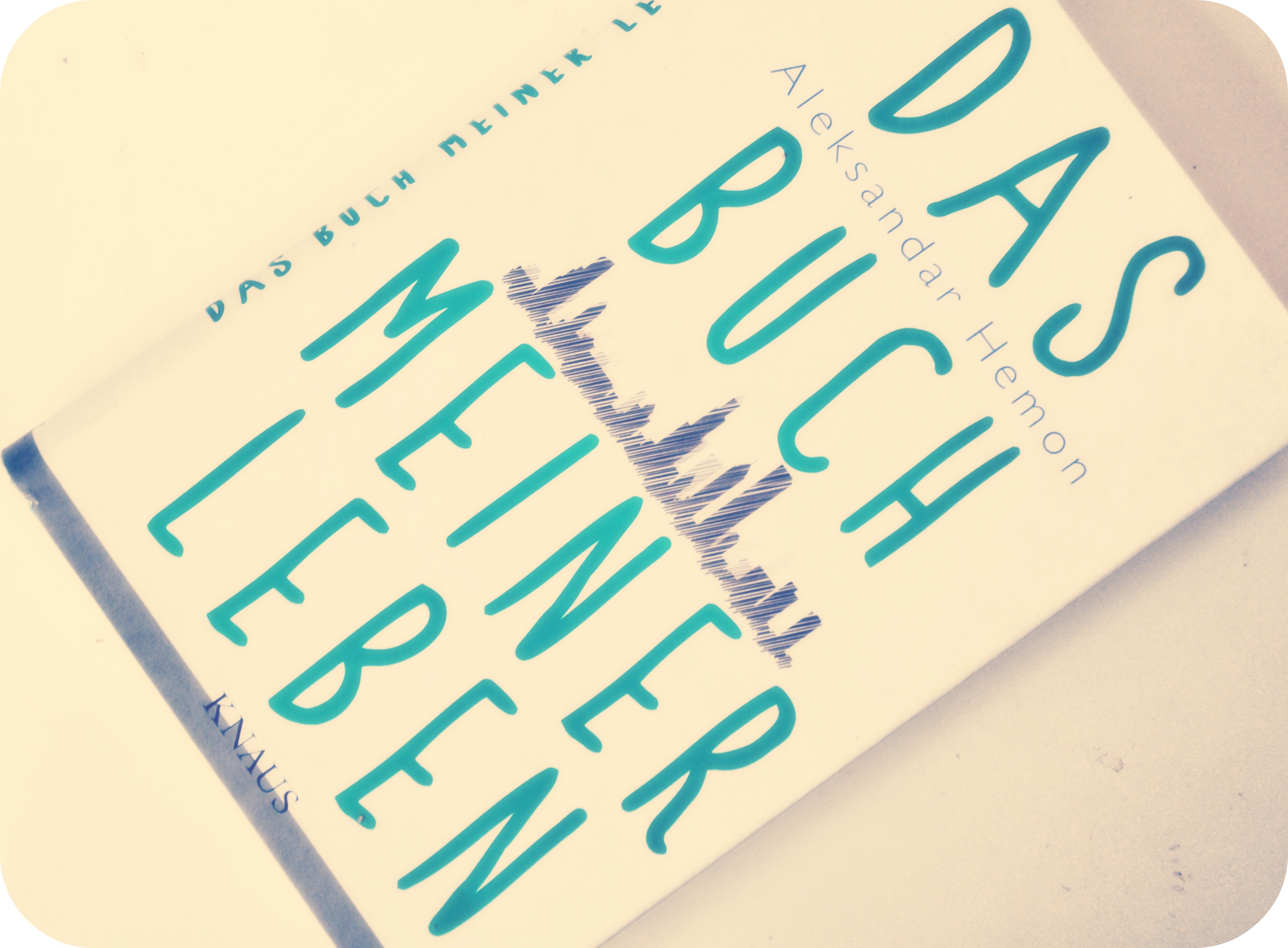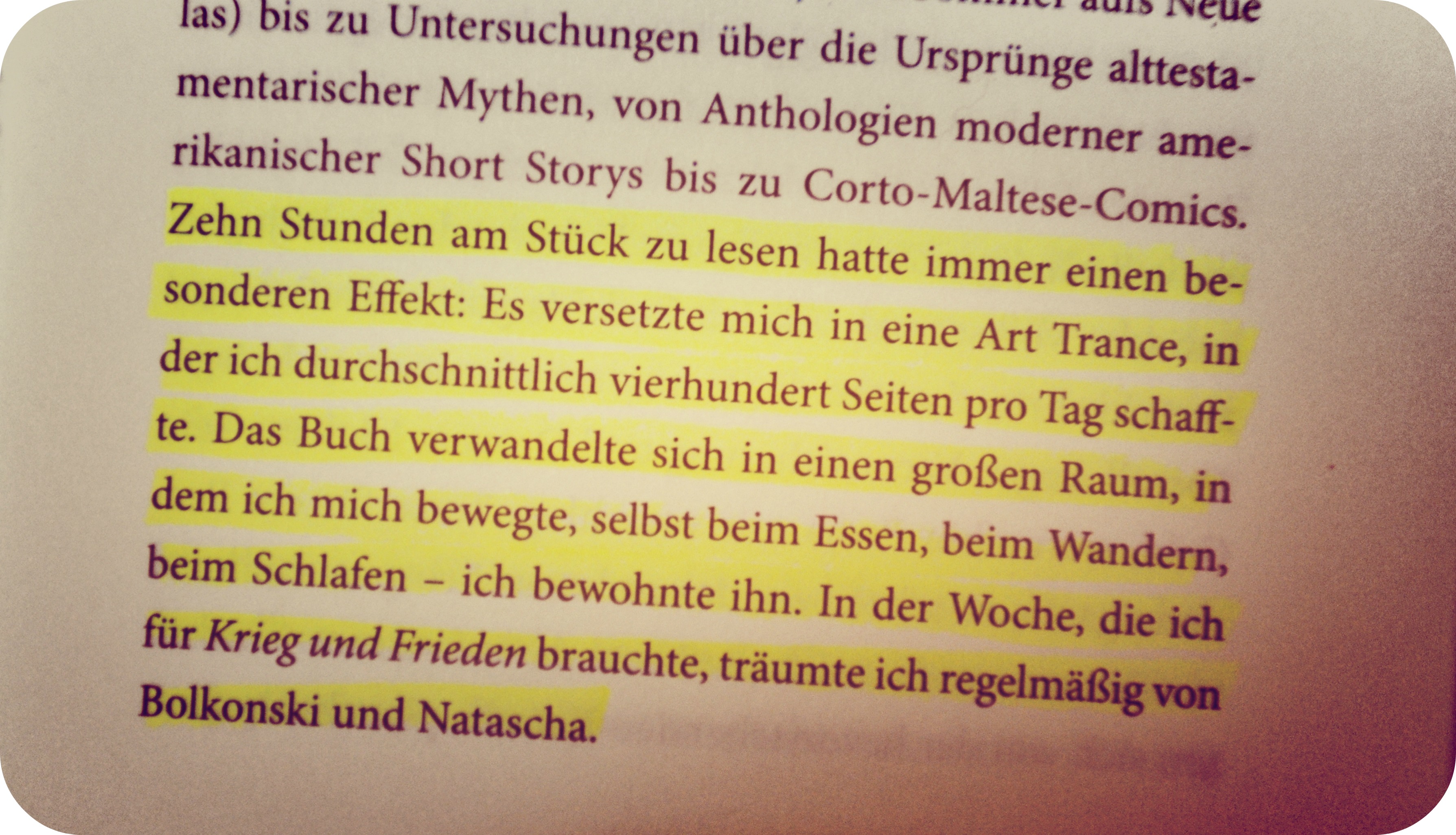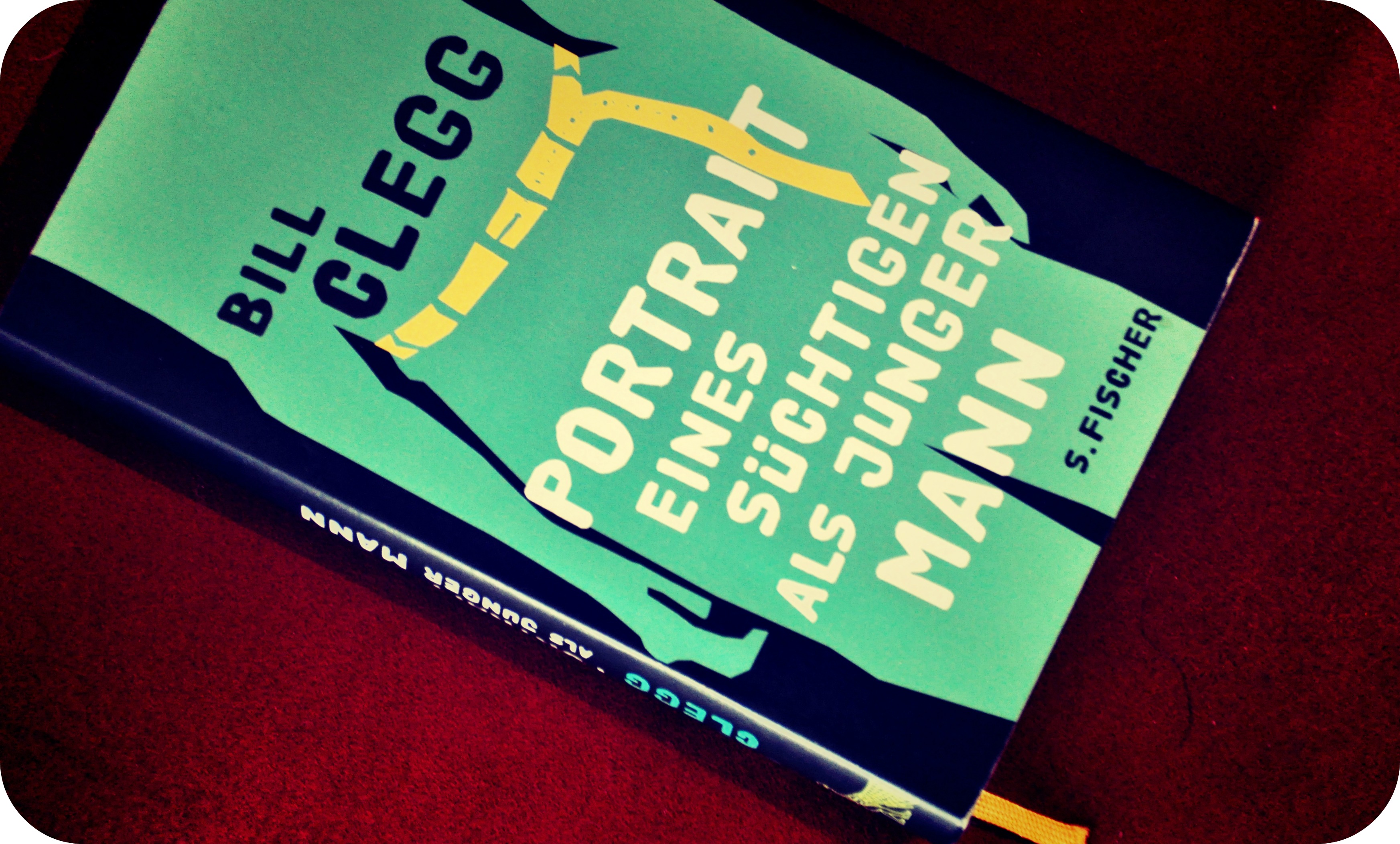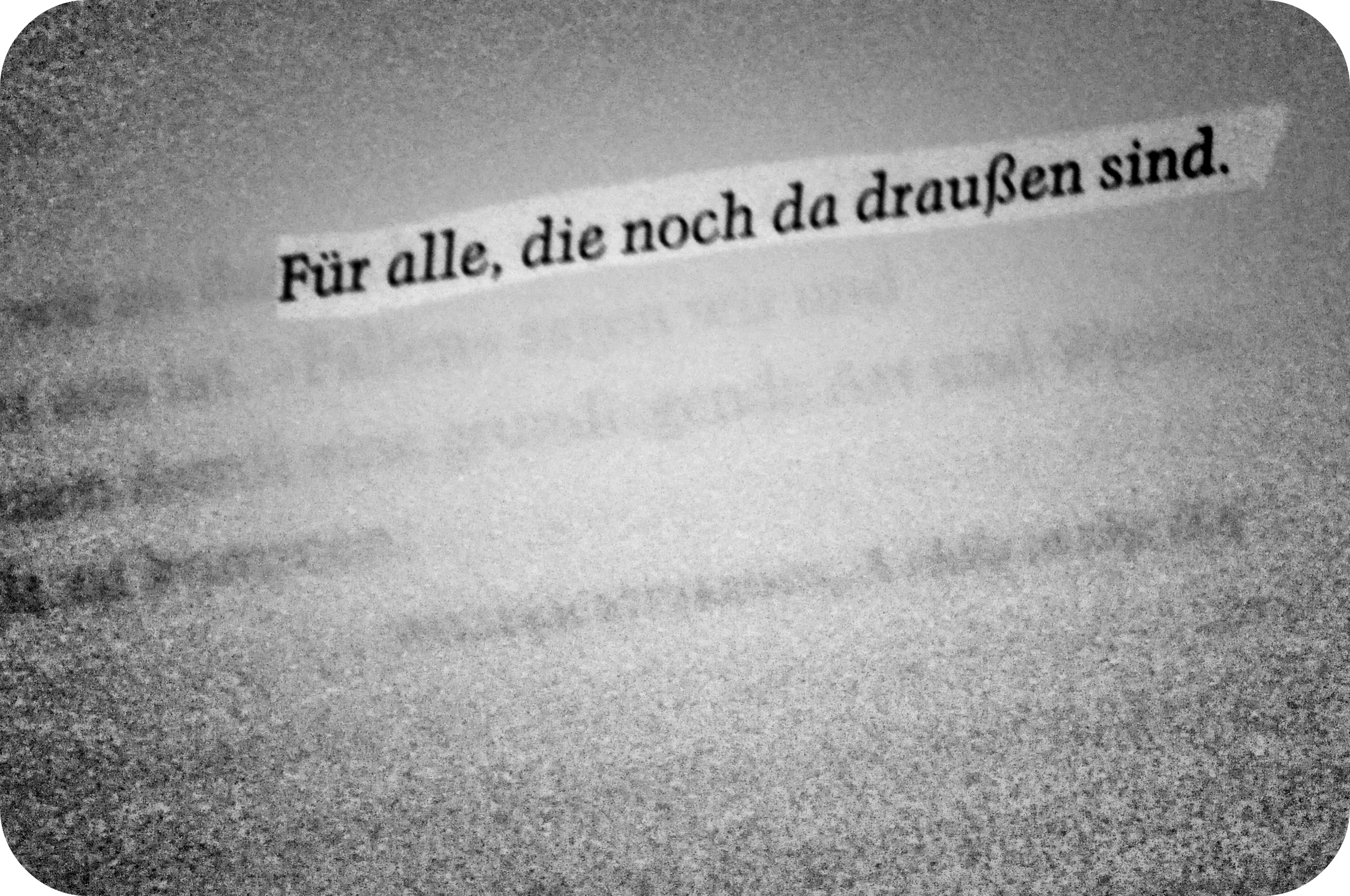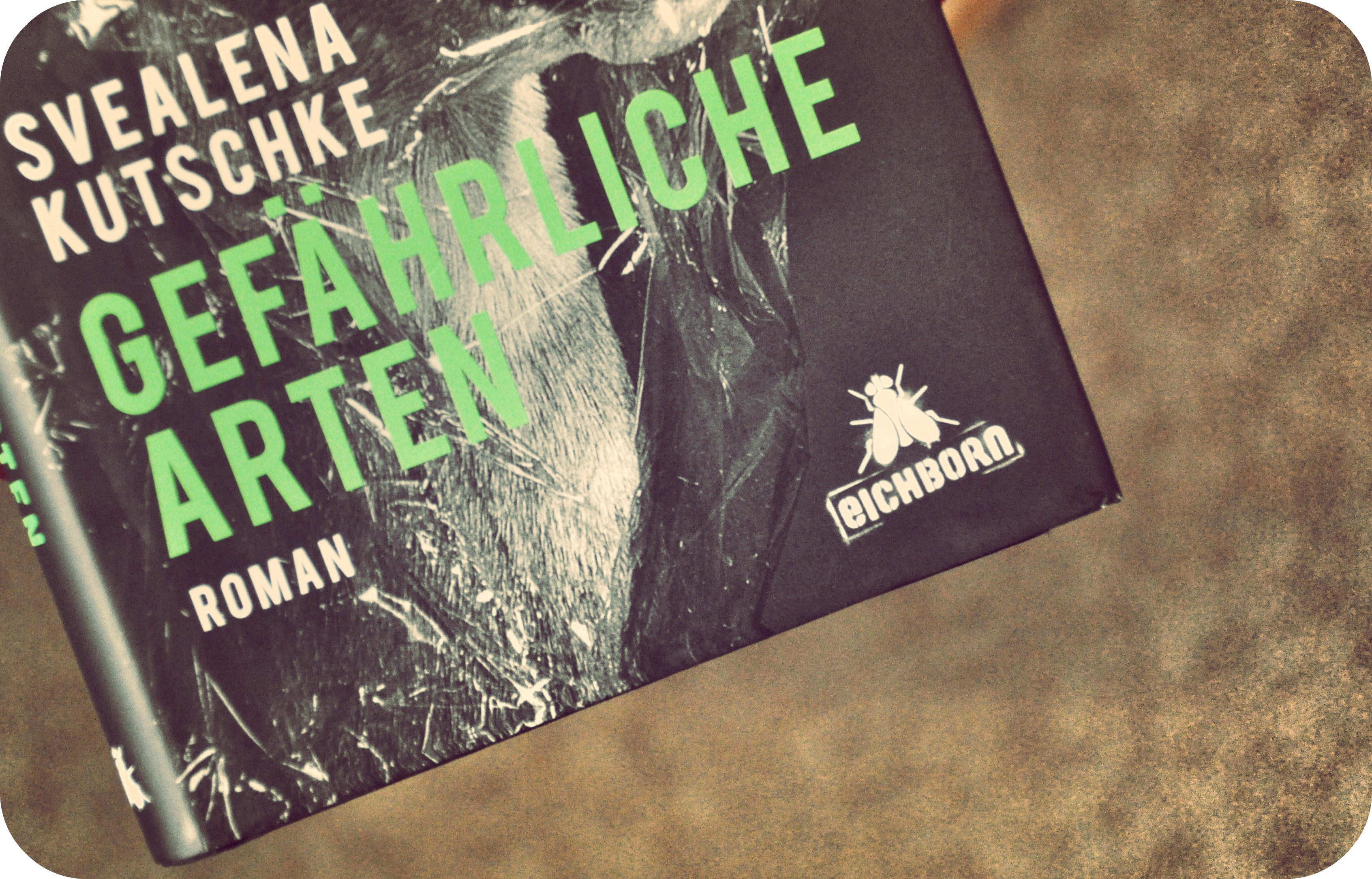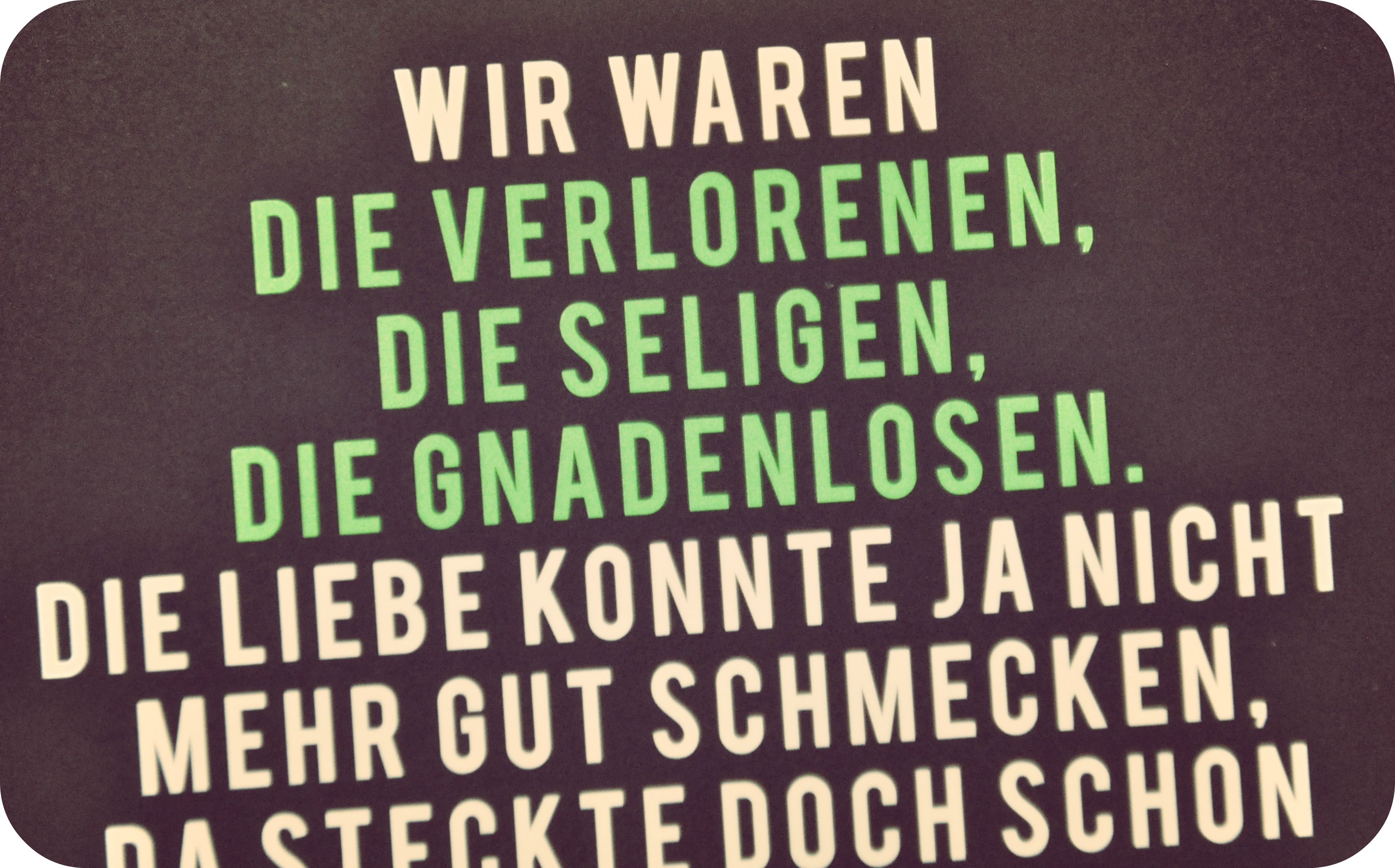Manchmal ist der Weg, auf dem Bücher zu mir gelangen, verschlungen und rätselhaft. Ich kann mir selbst nicht erklären, was mich direkt nach der Lektüre von “Die irre Heldentour des Billy Lynn” zu Shani Boianjius Roman greifen ließ. Manchmal ergeben sich beim Lesen von Büchern seltsam anmutende Querverbindungen und in diesem Fall ist es nicht nur der sogenannte “dog tag” auf dem Buchcover, sondern auch das Thema Krieg, was beide Bücher miteinander verbindet. Während der Krieg bei Ben Fountain lediglich eine Nebenrolle spielt, rückt er bei Shani Boianjiu ins Zentrum des Geschehens. Die Autorin wurde 1987 in Jerusalem geboren und hat irakische und rumänische Wurzeln. Mit “Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst” legt sie ihren ersten Roman vor. Aus dem Englischen übertragen wurde der Roman von Maria Hummitzsch und Ulrich Blumenbach.
“Das lag daran, dass ich nicht begreifen konnte, dass ich eine Soldatin war. Ich dachte, ich wäre immer noch ein Mensch.”
Lea, Avishag und Yael sind drei Mädchen, die in einem israelischen Dorf an der Grenze zum Libanon leben. Es ist ein kleines Dorf, in dem es keinen Handyempfang gibt, doch dafür ein Münztelefon und einen Videoautomaten. Eine kleine Schule gibt es auch, Lea, Avishag und Yael vertreiben sich dort ihre Zeit, wenn sie nicht gerade in Tagträumen bei Avishags älterem Bruder Dan sind. Der Dorflangweile wird der immer im Hintergrund lauernde Krieg entgegengesetzt. Da der Militärdienst auch für Mädchen verpflichtend ist, muss man sich kaum Gedanken über die eigene Zukunft im Anschluss an die Schule machen – der Weg ist vorgezeichnet und führt für viele junge Frauen zwangsläufig in den Krieg. Um die Ängste und Ungewissheiten auszulöschen, trinken die Mädchen Bier, rauchen und machen rum. Eingezogen werden sie trotzdem: als Frauen müssen sie die wahre Gefahrenzone des Krieges nicht betreten und doch nehmen sie an den Außenrändern dieses Krieges teil.
“Bald sind Avishag und ich mit der Schule fertig. Und gehen zur Armee. Und alles. Sogar Prinzessin Lea muss zur Armee. Alle müssen.”
Die Kriegsmaschinerie zieht Frauen ein, um sie nach ihrem Militärdienst wieder auszuspucken. In der Zwischenzeit sollen sie ihre Funktion erfüllen, ihre Rolle spielen und dabei möglichst wenige Fragen stellen. Die Situationen, die Shani Boianjiu einfängt und beschreibt, muten stellenweise fast schon kafkaesk an, sie sind aberwitzig und spotten jeder Beschreibung. Einer der Mädchen muss Stunde um Stunde auf einen Zaun starren, einer anderen fallen beim stundenlangen Betrachten eines Bildschirms beinahe schon die Augen aus dem Kopf.
“Und ich rede. Ich habe so lange gewartet. Das ist die Gelegenheit. Solange ich kurz vorm Ersticken bin, darf ic das. Yael und Lea sind nicht da, um mich mit ihrem Geplapper abzuwürgen. Von meiner Familie ist auch keiner da, der mich ignorieren kann. Meine Worte dienen einem Zweck. Meine Worte und Tränen sind eine Angelegenheit der nationalen Sicherheitspolitik. Ein Teil unserer Ausbildung. Dadurch bin ich auf einen Angriff mit nicht-konventionellen Waffen vorbereitet. Ich könnte das ganze Land retten, so gut bin ich vorbereitet. Mein ganzer Kopf brennt, aber die Worte purzeln mir nur so aus dem Mund, sie schmecken nach Bananen, und es kommen immer mehr.”
Shani Boianjiu erzählt in “Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst” die Geschichte von drei Mädchen. Es sind drei ganz unterschiedliche Geschichten, drei verschiedene Lebensläufe, drei Menschen, die voneinander getrennte Erfahrungen machen und doch von der Tatsache vereint werden, dass sie dazu gezwungen sind, viel zu schnell und viel zu früh erwachsen zu werden. Die Kapitel werden abwechselnd aus der Perspektive von Lea, Yael und Avishag erzählt. Es ist nicht immer leicht, die unterschiedlichen Ichs auseinander zu halten und zuzuordnen.
“Wenn du wirklich willst, dann verrate ich dir die Worte, die ich geschrien habe, ich verrate dir die Laute und Wörter und Buchstaben. Aber zuerst musst du schwören, dass du sie von mir hören willst.”
Während Ben Fountain mit “Die irre Heldentour des Billy Lynn” ein wahrlich flotter und leicht lesbarer Roman gelungen ist,verweigert sich “Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst” einem einfachen Zugang. Der Roman ist aufgebaut wie ein Mosaik; zusammengesetzt aus Einzelteilen, die nicht immer zueinander passen wollen. Die Sprache wirkt mitunter ungelenk und holprig, dann wiederum gibt es Passagen, die eine enorme Sogwirkung auf mich hatten, die vor Wut und Kraft so stark glühten, dass man fürchten musste, sich an ihnen zu verbrennen. Und doch wird der Roman von einer seltsamen Emotionslosigkeit bestimmt. Dem, was die Mädchen im Krieg erleben, nähert sich Shani Boianjiu nur bis auf eine gewisse Distanz. Sie erzählt, sie verweigert sich aber jeder Deutung oder näheren Beschreibung. Sie zeigt etwas, verzichtet jedoch auf eine Erklärung. Von den Geschehnissen im Roman bleibe ich deshalb immer wieder seltsam getrennt, wie durch eine Glaswand. Ich kann hindurch sehen, ich kann aber nicht auf die andere Seite gelangen. Weder das Geschehen, noch die Mädchen – die vor meinem inneren Auge immer wieder zu einer Person verschwimmen, kommen mir dadurch nahe.
“[…] ich begriff, dass es Menschen gab, die für den Kampf lebten, für den Moment, bevor man gewann oder verlor. Menschen, denen diese Welt nicht genug war; sie wollen eiskaltes Wasser in den Adern, Schönheit um jeden Preis, Klettern aus Gräben unter Beschuss, explodierende Granathalsketten. Faszinierende Menschen, die sich noch nicht einmal vorstellen konnten, dass es Folter gab. Und ich schaute die vielen Männer auf dem Sand an. Jeder Einzelne hatte Schultern, die breiter waren als meine, aber ich wusste, dass sie ihnen in dem, was kommen würde, nichts nutzen würden. Und da wusste ich: Ich war nie einer von diesen faszinierenden Menschen.”
Shani Boianjiu hat einen Roman geschrieben, der den Leser aussperrt. Ich habe keinen Zugang gefunden, weder zu der Sprache, noch zu den jungen Frauen und ihrem Schicksal. Der Versuch, sich dem Text zu nähern und sich auf ihn einzulassen, erfordert Zeit und Mühe. Dennoch gewährt die Autorin in “Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst” einen faszinierenden und bemerkenswerten Blick auf die Institution Militär, aber auch auf die Traumatisierungen, die man in einem Krieg erleben kann.