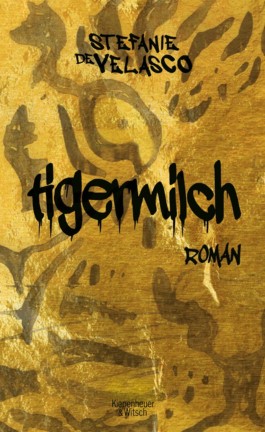 Stefanie de Velasco wurde 1978 in Oberhausen geboren und hat in Bonn, Berlin und Warschau studiert. Sie wurde bereits mit dem Literaturpreis Prenzlauer Berg und mehreren Stipendien ausgezeichnet. Derzeit ist sie Stipendiatin der Drehbuchwerkstatt München; Stefanie de Velasco lebt und arbeitet in Berlin und legt mit “Tigermilch” ihr Romandebüt vor.
Stefanie de Velasco wurde 1978 in Oberhausen geboren und hat in Bonn, Berlin und Warschau studiert. Sie wurde bereits mit dem Literaturpreis Prenzlauer Berg und mehreren Stipendien ausgezeichnet. Derzeit ist sie Stipendiatin der Drehbuchwerkstatt München; Stefanie de Velasco lebt und arbeitet in Berlin und legt mit “Tigermilch” ihr Romandebüt vor.
“Wir müssen üben, für später, für das echte Leben, irgendwann mal müssen wir ja wissen, wie alles geht. Wir müssen wissen, wie alles geht, damit uns keiner was kann.”
Nini und Jameelah wachsen in derselben Berliner Siedlung auf. Beide sind erst vierzehn Jahre alt, fühlen sich aber schon lange erwachsen. Mit elf Jahren zieht Nini das erste Mal an einer Zigarette, mit vierzehn macht sie das erste Mal ein Kondom mit dem Mund drauf. Das Lieblingsgetränk der unzertrennlichen Freundinnen ist die selbstgemischte Tigermilch: “ein bisschen Schulmilch, viel Maracujasaft und ordentlich Mariacron in den Müllermilchbecher”. Müllermilch ist für Kinder, Tigermilch für Erwachsene. Das Ende der Kindheit steht für Nini fest, als sie zum ersten Mal eine richtige Kindheitserinnerungen hat, denn “Erinnerungen aus der Kindheit kann man doch nur haben, wenn man selbst kein Kind mehr ist”. Jameelah kann sich kaum an ihre Kindheit erinnern, die sie im Irak verbracht hat – das ist aber auch gar nicht schlimm, denn eigentlich will sie gar nicht ganz erwachsen werden, “nur gerade genug, dass ich in alle Clubs reinkomme”. Nini und Jameelah fühlen sich so erwachsen, dass sie manchmal heimlich Ringelstrümpfe anziehen, die sie bis zu den Oberschenkeln hoch ziehen, und so auf die Kurfürsten gehen. Das gehört zu ihrem Projekt Entjungferung, das sie diesen Sommer unbedingt abschließen wollen.
“Mamas Sofa ist eine Insel, auf der sie lebt. Und obwohl diese Insel mitten in unserem Wohnzimmer steht, versperrt dicker Nebel die Sicht. An Mamas Insel kann man nicht anlegen.”
Am liebsten verbringt Nini ihre Zeit gemeinsam draußen mit Jameelah, denn ein Zuhause hat sie zwar, aber heimisch fühlt sie sich dort nicht. Ihre Mutter schläft den ganzen Tag auf dem Sofa, während ihr richtiger Vater schon lange abgehauen ist. Ihre Schwester Jessi ist ein Unfall gewesen und mit ihrem neuen Stiefvater versteht sie sich kaum.
“Ich würde gern aufstehen und gehen, ich will nach Hause, aber zu Hause, ist das bei Rainer und Jessi, bei Mama und ihrem Sofa? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo ich hinwill, ich will auf Amirs Linde und so weit hochklettern, dass mich die grünen Blätter ganz bedecken und mich keiner finden kann, ich will das dünne Ende vom Wollfaden in den Ästen suchen und mich wie ein Äffchen daran festhalten, so lange, bis jemand die Welt unter mir wieder zusammengeklebt hat.”
Ihr Zuhause ist von Sprachlosigkeit geprägt, dabei bedeuten ihr Wörter doch so viel. Nini und Jameelah schwanken zwischen dem Wunsch nach einer heilen Kindheit und der harten Welt der Erwachsenen, hinter einer rauen Schale verbergen beide Traurigkeit aber auch eine kindliche Freude am Leben und an der Sprache. Beide haben sich die O-Sprache ausgedacht und knacken am liebsten auf dem Balkon Wörter.
“Jameelah liebt es, Buchstaben zu vertauschen, Wörterknacken nennt sie das. Aus Luft macht sie Lust, aus Nacht nackt, Lustballons, Nacktschicht, Lustschutzkeller mit Nacktwärtern. Wir sprechen außerdem O-Sprache, Geld ist Gold, mit Filter drehen gibts nicht mehr, nur mit Folter drohen.”
Ein Gefühl von Heimat bekommt Nini, wenn sie durch die Stadt fährt und Graffitis von Nico sieht – überall hinterlässt er sein Kürzel “Sad”. Wenn sie an einem “Sad” vorbeifährt, fühlt sie sich nicht mehr alleine. Und dann gibt es da auch noch ihre Freunde, vor allem Amir, der auf dem Zehnmeterbrett steht, aber sich vor lauter Angst nicht traut, herunterzuspringen. Amirs großer Bruder Tarik ist nicht nur ein großer Bruder, sondern auch ein großer Beschützer, der auch seine Schwester Jasna beschützen möchte, denn Jasna hat sich in einen Serben verknallt. Der Wunsch Jasna zu beschützen gerät jedoch zunehmend außer Kontrolle, bis zu dem Moment, als Nini und Jameelah miterleben müssen, wie die Auseinandersetzungen drohen, nicht nur Amirs Familie zu zerstören, sondern auch Ninis selbsterwählte Ersatzfamilie …
“Wieso hat uns nie jemand gesagt. dass das hier passieren kann, frage ich mich, wieso hat uns niemand gesagt, dass das hier passieren kann.”
Stefanie de Velasco legt mit “Tigermilch” ein erstaunliches und sehr beeindruckendes Debüt vor, das ich in dem Wunsch gelesen habe, es nicht mehr aus der Hand legen zu müssen. “Tigermilch” zeichnet sich durch eine faszinierende Erzählstimme aus: Stefanie de Velasco trifft einen unglaublich eingängigen Ton, der sich in meinem Kopf festgesetzt hat; bis heute. Dieser Ton ist auf der einen Seite humorvoll, es gibt viele Stellen, über die ich schmunzeln oder auch laut lachen musste. Viele Passagen sind von einer derben Sprache geprägt, sowohl Nini als auch Jameelah nehmen kein Blatt vor den Mund. Auf der anderen Seite schwingt in dem Erzählton aber auch Traurigkeit und eine nur schwer zu ertragende Einsamkeit und Verlassenheit mit. Nini glaubt schon lange erwachsen zu sein, doch eigentlich wünscht sie sich, an der Insel ihrer Mutter anlegen zu können, um so etwas wie ein Zuhause zu erleben – stattdessen sitzt sie in Ringelstrümpfen auf der Kurfürsten. Stefanie de Velasco schreibt über zwei Mädchen, die keine Kinder mehr sind und viel zu schnell gezwungen wurden, erwachsen zu werden. An der Stelle im Geldbeutel, wo andere Fotos ihrer Familie aufbewahren, klemmt bei Nini ein Kondom, um das Projekt Entjungferung jederzeit abschließen zu können. Irgendwann stellt sie verbittert fest, dass das echt Leben “Seitenstiche, Pornos und der Geschmack von Blut” ist.
“Bis jetzt dachte ich immer, manche Dinge bleiben für immer, die ändern sich nie, die verschwinden nicht, genau wie in Biologie diese versteinerten Tiere, die angeblich Millionen von Jahren alt sind. Das stimmt aber nicht, gar nichts versteinert, Jameelah hatte recht, alles wird immer anders, obwohl man es gar nicht will.”
Beeindruckt an diesem außergewöhnlichen Debütroman hat mich vor allen Dingen die Sprache, durch die nicht nur ein ganz besonderes Lebensgefühl transportiert wird, sondern auch der Duft der Straße. Die Sprache ist rau, derb, aber dann auch wieder stellenweise wunderbar poetisch und kunstfertig. Manche Sätze muss man schälen, bis man auf ihren inneren Kern stößt, einen Kern, den eine bodenlose Traurigkeit umweht.
“Dass wir hierhergezerrt werden, auf diese Welt. Ich meine, keiner fragt dich danach, keiner fragt dich, ob du das überhaupt willst.”
Stefanie de Velasco gelingt es in ihrem Debütroman wunderbar erschreckend, authentisch und lebendig das Lebensgefühl von vierzehnjährigen Mädchen einzufangen. Das Buch trägt die Widmung: “Für Mädchen”, es sind Mädchen, die ihre Familie nicht zu Hause finden, sondern auf der Straße. Mädchen, die auf sich alleine gestellt sind und alles dafür tun, um nur schnell erwachsen zu werden. Mädchen, die mit zwanzig Euro Taxigeld alleine in das Kinderkrankenhaus geschickt werden, weil die Eltern keine Zeit haben mitzugehen. All diesen Mädchen gibt die Autorin eine Stimme, eine wunderbar eingängige Stimme, von der man all das Derbe und Heitere abkratzen muss, um auf die Traurigkeit und Einsamkeit hinter der Fassade schauen zu können. “Tigermilch” ist ein ausdrucksstarker, kraftvoller und poetischer Debütroman, der mich begeistert hat.



 Simone Regina Adams wurde 1967 geboren und hat fünfzehn Jahre lang als Psychotherapeutin gearbeitet, bevor sie sich entschieden hat, hauptberuflich als Autorin tätig zu sein und ein literaturwissenschaftliches Studium aufzunehmen. Ihr Roman “Die Halbruhigen”, der in diesem Frühjahr im Aufbau Verlag erschien, wurde bereits 2011 mit dem Werner-Bräunig-Preis ausgezeichnet.
Simone Regina Adams wurde 1967 geboren und hat fünfzehn Jahre lang als Psychotherapeutin gearbeitet, bevor sie sich entschieden hat, hauptberuflich als Autorin tätig zu sein und ein literaturwissenschaftliches Studium aufzunehmen. Ihr Roman “Die Halbruhigen”, der in diesem Frühjahr im Aufbau Verlag erschien, wurde bereits 2011 mit dem Werner-Bräunig-Preis ausgezeichnet. 1976 wurde Jonas Lüscher in der Schweiz geboren, heutzutage lebt der Autor in München und arbeitet als Doktorand am Lehrstuhl für Philosophie der ETH Zürich. Mit “Frühling der Barbaren” legte der Autor in diesem Bücherfrühjahr sein Debüt als Schriftsteller vor.
1976 wurde Jonas Lüscher in der Schweiz geboren, heutzutage lebt der Autor in München und arbeitet als Doktorand am Lehrstuhl für Philosophie der ETH Zürich. Mit “Frühling der Barbaren” legte der Autor in diesem Bücherfrühjahr sein Debüt als Schriftsteller vor.
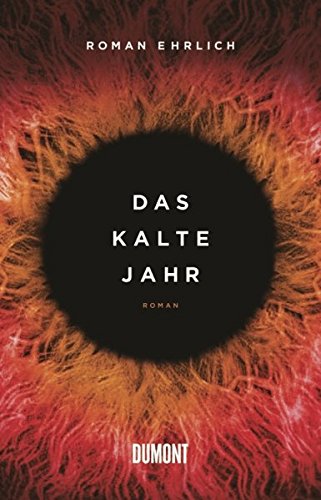 1983 wurde Roman Ehrlich in Aichach geboren. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der Freien Universität Berlin. “Das kalte Jahr” ist das Romandebüt dieses jungen Autors, der bereits Stipendiat der Werkstatttage des Wiener Burgtheaters war und an der Autorenwerkstatt Prosa am LCB teilgenommen hat.
1983 wurde Roman Ehrlich in Aichach geboren. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der Freien Universität Berlin. “Das kalte Jahr” ist das Romandebüt dieses jungen Autors, der bereits Stipendiat der Werkstatttage des Wiener Burgtheaters war und an der Autorenwerkstatt Prosa am LCB teilgenommen hat.